

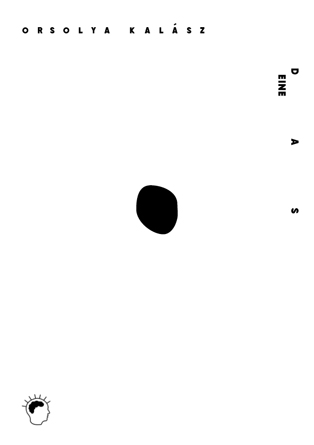

«Tom Schulz: Das globale poetische Gras»
Von Andreas Kohm
Wer sich über die dunklen Flecken der historischen Karten oder die Dämmerstunden der privaten Geschichte beugt, kann ins Bodenlose fallen – oder aber in einen virtuosen Flugmodus übergehen und dann in einer Weise von ihnen berichten, die ihnen ihre Schwere und Dunkelheit belässt, ohne dabei die Leichtigkeit preiszugeben.
Tom Schulz unternimmt in seinem neuen Gedichtband «Die Verlegung der Stolpersteine» eine poetische Luftaufklärung über einem global anmutenden und mit zahllosen Anlässen dicht verminten Terrain der Trauer des 20. und 21. Jahrhunderts: das vom Grauen des Holocaust sich ausbreitet bis tief hinein in die abgründig stille Heiterkeit der Kindheitserinnerungen in der DDR. Oder die Wohlfühllaunen touristischer Allerweltskosmopoliten und scheinbar heimeliger Idyllen durchdringt, in die man sich plaudernd und zweifelsfrei eingerichtet hat.
Wie hoch die Strahlengefährdung aber des sich selbst beruhigenden Darüberhinwegsehens, wie hochkontaminiert bereits die Sprache des vermeintlichen reinen Zwecks ist, zeigt sich auch heute erst bei näherem Hinhören und Hinsehen auf eine nur noch vordergründig intakte Welt.
Etwa im Zyklus „Die Kühe am Atomkraftwerk“: „Die Kühen kauen Gras/ wir legen uns einen Säureschutzmantel an/ dann versiegeln wir das Fleisch// Verschliessen die Erbinformation/ jedes Genom wird datenrechtlich erfasst/ geschützt und weiterverkauft// Wir fahren mit dem Fahrstuhl in die Unterwelt/ in einen Keller, wo die Geweihe hängen/ wenn man uns in ein Glas schraubt, sehen wir// Traurig aus, wir blicken durch den Zahn/ des Mammuts, in eine Schwermut-Galaxie/ auf den Bildern erste dunkle Flecken“.
Der Dichter Tom Schulz, 1970 in der Oberlausitz geboren, hat ein aufmerksames Ohr für die Unter- und Zwischentöne, die er zum Klingen bringt und denen er mit grosser Gelassenheit, fast Heiterkeit, ihre Dissonanzen und Wider-Sprüche entlockt – und darin ihren eminent politischen Gehalt offenbart. Deshalb auch ist sein poetisches Ich sich seiner Aufspaltung ins vielstimmige poetische „Wir“ bewusst und nicht nur unbedacht hingesagt.
Schillernden Vexierbildern gleich geben die in den Gedichten eröffneten Bildräume in einem imaginären „Haus der Sprache“ ihre vielschichtigen Erinnerungen zu erkennen, mit denen sie die Gegenwarten unweigerlich bis ins Körperliche hinein durchdringen. Äusserst fein gearbeitet verschränken sie Daten des sogenannten kollektiven Gedächtnisses mit Partikeln aus den Erzählungen der Grosseltern; sie rufen poetische Gewährsleute wie Paul Celan und Kurt Vonnegut an, befragen Orte und Träume, die in sie und in die sie hineingeraten sind: „(…) Wieviele Sommer gehören/ den Lebenden? Wir stellen die Leiter in die Scheune. Es gibt den Kuhstall in der Erinnerung: wir selbst ganz klein vor grossen Tieren./ Es gibt den Kuhstall, nicht das Nichts. Den Heuboden, den Schlaf,/ die Träume. Das Erwachen. Woher wissen wir, von wem nichts? (…)“
Schulz weiss um die Gefahr, dass über alles das Vergessen und das Gras wachsen kann – dass jedoch auch das beinahe globale poetische Gras in vielen dieser 72 Gedichte eine Rettung verbürgen könnte.
Tom Schulz
Die Verlegung der Stolpersteine
Gedichte
Hanser Berlin 2017
128 Seiten, € 18.
«Orsolya Kalasz: Ausser sich ist wo?»
„Das Eine“ – und das Viele. Und das Andere? Das – wie um alles in der Welt! – uns umtreibt, beunruhigt, staunen macht. Da draussen die Welt, da drinnen in mir. „Alles ist da“. In nuce?
Die mit dem Peter-Huchel-Preis 2017 ausgezeichnete Lyrikerin Orsolya Kalász unternimmt in den 37 Gedichten des ausgesprochen schön gestalteten Bandes «Das Eine» die poetische Probe auf’s Exempel: ob denn die Sprache das Ich in seinen zersplitterten Gefühls- und Bewusstseinszuständen abzutasten vermag; ob denn Grenzen zu überschreiten sind hin zu einem heilen Zustand, in unseren Körpern; ja, ob etwas wie Liebe überhaupt beschreibbar ist. „Übung// Sich/ einem ekstatischen Geflecht/ aus Verschlingungen,/ Kurven,/ Schleimhäuten,/ imaginären Verlängerungen/ anvertrauen,/ einzig und allein,/ um die mörderischen Vorübungen/ der Verschriftlichung zu überstehen.“ Das Gedicht, einsames, gefahrvolles Exerzitium in der Überfülle? Inmitten der Widersprüchlichkeit der einen Welt letzter, einziger Halt durch rauschartige Hingabe? Oder einfach nur Ort für den „Gedanken,/ die Evolution verfeinere sich/ indem sie darauf bestehe,/ die Schauer des Entzückens/ ungefragt auszulösen.“
Bereits die antike Philosophie sucht nach intelligiblen Möglichkeiten, Dissonanzerfahrungen und Paradoxien auszuhalten, und findet – neben den Ritualen und psychoaktiven Stoffen der religiösen Kulte – Denkfiguren des Harmonischen, die das Trennende als das Verbindende, den Gegensatz als das Einende begreifen. Und wenn ein Friedrich Hölderlin in seinen Überlegungen die „Verfahrungsweise des poetischen Geistes“ rückbindet an Platon und Heraklit, wenn er im „Hyperion“ eine Poeto-Logik der Schönheit umreißt, dann versucht er damit rettende Brücken der Kontinuität hinein in und über die bereits erkennbare Zerrissenheit der Moderne zu schlagen.
Auch Kalász‘ Gedichte über „das Eine“ lassen sich als späte Echos solcher meta-physischen Eros-Konzepte verstehen, als Liebes-Gedichte – allerdings radikal in die eigene Körperlichkeit verlagerte, seismosgrafische Messungen in deren Grund und Abgrund. Und doch, bei allem Liebes-Leid angesichts einer enzyklopädisch nie abschließbaren Erforschung dieser Geschichte der (eigenen und fremden) Natur, bleibt da eine tiefste Vertrautheit zu den Dingen und ihrer Seinsweise. Sie verbürgt „unsere Stetigkeit“, hörbar gemacht in hoch verdichtetem, dabei auf’s Nüchterne herabgekühlten Gesang: „Später/ wie so oft,/ werden/ Ding und Ding/ wirklich/ ineinander überführt,/ und an den Schnitten/ zum lieben Lied/ zusammengefügt. (…) Das liebe Lied,/ das liebe, liebe Lied,/ wird noch einmal/ überführt und gedehnt, gestaucht,/ verbogen und gedrückt,/ bis es mehr wie eine Nuss ist,/ und wir, du Ding/ sind die anderen zwei Nüsse (…) Komm, Ding, komm,/ komm schnell, vertrau mir,/ immerhin/ sind wir einander verwandt.“
Die heute in Berlin lebende Dichterin und Übersetzerin Orsolya Kalász, 1964 in Ungarn geboren, ist zweisprachig aufgewachsen und in ihren drei bisher vorgelegten Gedichtbänden stehen die Gedichte noch jeweils in beiden Sprachen deutsch-ungarisch nebeneinander, als seien es Variationen der ‚einen‘ Sprache, momentane Positionsbestimmungen der Poesie. In „Das Eine“ ist die zweite Sprache gleichsam aufgehoben und über-setzt in eine ihre fragilen Bilder bedächtig umkreisende, schwebende Diktion, die in der „Realwelt“ ein Surreales zu fassen sucht, ohne die schillernden, bizarren Konstellationen zu zerstören: „Etwas, was mit keiner mir bekannten Tat/ in Verbindung gebracht werden kann,/ sehe ich/ einen rot-silbern geteilten/ Schwanenrumpf in Gold/ auf Meereswogen/ eine gekrönte Melusine. // Das war ich erst vorige Woche/ sage ich dann.“
So entstehen sinnlich üppige, atmosphärisch dichte, in einem Gespinnst von Motiven, Farben und Lauten fein miteinander verwobene und pulsierende Gedichträume, in denen mit fast prosaischen Worten und Tonfall ebenso von „Fabeltieren“, „Zungen mit Heiligenschein“ und „brennende(n) Bomben“ die Rede ist, wie von Phänomenen des Alltags, „Amselei“ und „Mülltonne“, dem „würzigen Duft alter Rosen“, „Pappelblätter(n)“ oder der „S-Bahn“. Es sind poetische Transiträume von bisweilen halluzinatorischer Intensität, wie in Gesichten geschaute Tableaus, die dem eine vorübergehende Gestalt geben und zur Sprache bringen, was sich in ruhig fließenden Gestaltwechseln vor „Auguren-Augen“ vollzieht.
Indem Kalász – nicht unähnlich der von ihr verehrten Gertrud Kolmar in ihrem 1934 veröffentlichten Gedichtband „Preußische Wappen“ – ihre Gedichte in ein produktives Spannungsverhältnis zur Heraldik, zur Beschreibungskunst von Wappen bringt, gibt das unter seinen (Zu-)Rüstungen verborgene Ich bisher Unbekanntes und Unbenanntes preis, entdeckt „in der Verdeutlichung durch Übertreibung“ vielleicht das, was es ‚im Schilde führt‘. Und lauscht Selbst-Gesprächen zwischen „ich“ und „du“, die traumwandlerisch und visionär sind: wenn sie mit elegisch gebrochener Ironie auch Trauer(t)räume eröffnen, in denen schmerz-, wie lustvoll jene Bildräume des Innersten nach außen sich kehren, wo ihr eigenes und fremdes Gegenüber in „Lieder(n)/ über die Liebe“ (un)heimlich zusammenklingt: „das, was in mir keine Augen hat/ schaut dir später beim Schlafen zu.“
Orsolya Kalász, Das Eine
Brueterich Press, Berlin 2016
85 S., 20 Euro

