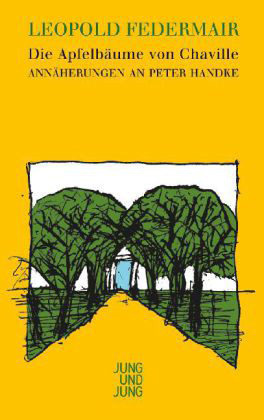«Peter Handke, ein Klassiker des 21. Jahrhunderts»
Von Leopold Federmair
Nach dem Briefwechsel zwischen Siegfried Unseld und Thomas Bernhard liegt nun auch die Korrespondenz des 2002 verstorbenen Verlegers mit seinem zweiten österreichischen Grossautor Peter Handke vor. Beide Bände haben in etwa gleichen Umfang, beide sind höchst aufschlussreich in Bezug auf das Werk des Autors und die Mechanismen des Literaturbetriebs.
Mit der Dramatik, stellenweise auch Komik des Bernhard-Bands kann es der Austausch zwischen Handke und Unseld nicht aufnehmen; er ist ruhiger, besonnener, aber dennoch nicht krisenfrei. Und er fasziniert im gleichen Mass, weil er es dem neugierigen Leser erlaubt, das schöpferische Innen- und Aussenleben eines Autors nachzuvollziehen, der sich mit Weitblick aus der Enge seiner Herkunft befreite und danach, anders als der monomanische Thomas Bernhard, die Welt und sich selbst immer weiter zu erkunden bestrebt war (und ist).
Das Potential des damals Zweiundzwanzigjährigen aus der fernen Provinz, von dem ein umfangreiches Romanmanuskript (Die Hornissen) im Verlag eingetroffen war, hat Unseld 1965 sofort erkannt. Nachdem sich der Erfolg eingestellt hatte, war er darauf bedacht, seinen Autor zu fördern, zu pflegen und, in den schwierigen Momenten, zu halten. Ist doch ein so arbeitseifriger Schreiber wie dieser für den Verleger ein Kapital, das er nicht brachliegen lassen darf. Umgekehrt wusste auch Handke das ökonomische Potential seines Partners zu nutzen – nicht so unverschämt, wie Bernhard es zuweilen tat, aber doch. Handke war dabei, das Vorhaben umzusetzen, das er 1961 seiner Mutter in einem Brief verriet und ein paar Jahre später in einem seiner sprachkritischen Texte auf den Punkt brachte: „weltberühmt werden.“
1975, als er die Selbstaufforderung bereits verwirklicht hat, lautet die gelassenere, nicht mehr grossmäulige, sondern selbstbewusste Variante im Brief an den Verleger: „Ich habe für mein Leben was vor, das ich mir selber vorgenommen habe, und das macht mich stark.“ Unterschwellig klingt im Briefwechsel durch, dass die Notwendigkeit, sich ein grosses Projekt zu geben, mit frühen Erfahrungen des Befremdens gegenüber den anderen zusammenhängt, mit einem Wegstreben aus der Gruppe und einer dann doch jedes Mal aufs neue einsetzenden Wiederannäherung, einem Eingliederungswunsch. Zuletzt hat Handkes dies in seinem Versuch über den stillen Ort in einer Begrifflichkeit ausgedrückt, die an „Wunschloses Unglück“ erinnert, die literarische Aufarbeitung des Selbstmords seiner Mutter, geschrieben im fernen Jahr 1972. Im Versuch spricht Handke vier Jahrzehnte später von seinem „Gesellschaftswiderwillen“ und von „asozialen“ oder „antisozialen Akten“, aber auch davon, dass es ihn nach einer Weile in der Abgeschiedenheit „zu den anderen, zu meinen Leuten“ hinzog. Ein solches Hin und Her schwingt im Briefwechsel mit, und an mindestens zwei Stellen spielt Handke mit dem endgültigen Bruch, dem „Austritt“ aus dem Suhrkamp-Universum, der Bücher-Firma.
Unseld hatte ein gutes Sensorium für solche Schwankungen, musste aber mehrfach in schwierige Lagen kommen, da er ja auch noch andere Autoren zu betreuen hatte. So sah er sich beispielsweise gezwungen, Thomas Bernhard gegen seinen österreichischen Antipoden in Schutz zu nehmen, der sich abfällig über ihn geäussert hatte („schamlose Schein-Literatur“).
Oder wenn Handke auf dem Verlegerschreibtisch ein Buch des von ihm gehassten Marcel Reich-Ranickis mit einer persönlichen Widmung entdeckte. Handke hatte für seine Reich-Ranicki-Verachtung konkrete Gründe, sie sind nachvollziehbar. Vermutlich liegen hier die ersten Regungen eines Konflikts mit der Welt der Massenmedien und, vor allem, ihrer Sprache, der sich in den neunziger Jahren zuspitzen sollte und bis heute anhält.
Literatur gegen Journalismus, bedachtsames, langzeitorientiertes Schreiben gegen die oberflächliche Eiligkeit, die nur auf das Heute blickt und das Geschäft einer Ideologie betreibt, die ihr oft gar nicht zu Bewusstsein kommt. Diesen Hintergrund von Handkes Engagement im Zusammenhang der Jugoslawien-Kriege beleuchtet Lothar Struck in einer umfassenden Studie über den Autor im „Spannungsfeld zwischen Literatur, Medien und Politik“. Man kann in den Werken Handkes die unterschiedlichsten literarischen Spuren, Traditionsbezüge, Transformationen entdecken. Ihn als einen neuen Karl Kraus im Zeitalter der Globalisierung zu betrachten, mag zunächst überraschen, doch die genauen Lektüren, die Struck von Handkes jugoslawischen Reiseberichten und von Texten wie Rund um das Grosse Tribunal vorschlägt, belegen, dass in seinem Werk eine folgerichtige Entwicklung von der frühen Sprachkritik zu seinen sprachkritisch grundierten Auseinandersetzungen mit der Medienberichterstattung stattfindet.
Fabjan Hafner hat in seiner 2008 erschienen Arbeit über die slowenischen Bezüge von Handkes Schreiben („Unterwegs ins Neunte Land“) die biographischen, familiengeschichtlichen und poetologischen Zusammenhänge herausgearbeitet, die den Autor für den Zerfall Jugoslawien besonders sensibel machten. Auf diese Vorarbeit kann sich Struck stützten, wie auch auf die Dokumentation Thomas Deichmanns („Noch einmal für Jugoslawien“), wenn er in chronologischer Reihenfolge die zahlreichen Handke-Texte auswertet, in denen Jugoslawien bzw. einzelne Länder und Landstriche des ehemaligen Staatenverbunds vorkommen und literarisch befruchtend wirken. Im Blick auf Biographie und Gesamtwerk des Autors kommt man dabei zu der überraschenden Feststellung, dass Handke, der in seiner Kindheit das Slowenische vor allem in der Kirche und manchmal vom Grossvater hörte (Spuren davon finden sich in seinem ersten Roman), im Zuge der allgemeinen kulturellen Umwälzungen der Nachkriegszeit auf Kino, Popkultur und Amerika als Sehnsuchtsland setzt und sich dabei den Herkunftstraditionen entfremdet, um sich in den achtziger Jahren diesen Traditionen neuerlich zuzuwenden, indem er das inzwischen vergessene Slowenisch neu lernte, Bücher von Gustav Januš und Florjan Lipuš übersetzte, Reisen vor allem nach Slowenien unternahm und schliesslich „Die Wiederholung“ schrieb, jenen in seinem Schaffen zentralen Roman, der nun Slowenien zum Sehnsuchtsland – „das Neunte Land“ – erklärt.
Struck zeigt, inwiefern die Reiseberichte aus den Konfliktgebieten, die Handke in den neunziger Jahren und darüber hinaus veröffentlichte, diese Entwicklung mit grosser Konsequenz weiterführen, indem sie der Kriegspropaganda Erzählungen aus dem Alltag, der verkommenen Journalistensprache eine feinfühlige, Fragen stellende Literatursprache und der medienbedingten Abstumpfung die Aufmerksamkeit für das unmittelbar Wirkliche entgegensetzen.
Der Briefwechsel zwischen Handke und Unseld geht über 37 Jahre, zusammen mit den im Buch dokumentierten Chroniken und Reiseberichten, die Unseld ziemlich lückenlos führte, zeigt er zahlreiche Aspekte des Autors. Besonders aufschlussreich ist er aber für die Zeit der schweren Lebens- und Schreibkrise, die Handke 1978 erfasste.
In diesem Jahr traf der Verleger seinen Autor in New York, sie wohnten sogar einige Tage im selben Hotel. Handke mühte sich mit dem Roman „Langsame Heimkehr“ ab und drohte an seinem Vorhaben zu scheitern. Man spürt, wie Unseld die Gefährdung erkennt und mit Handke mitleidet, aber auch, wie hilflos er in Momenten war, da die Kommunikation vor seinen Augen abbrach.
Hans Höller macht diese Krisenerfahrung zum Ausgangspunkt seiner Studie über Handkes Verhältnis zur Klassik. Immer wieder kommt er dabei auf eine Notiz in der Geschichte des Bleistifts zurück: „Das Klassische kann nur Ausdruck der Gefahr sein“. Goethe wird für Handke in der Krise zum Nothelfer. Die Literatur des Weimarers vewahrt ihrerseits Gefährdungen, die sie im schöpferischen Akt überwindet, und kann als solche Wege aus der Krise weisen. Es ist eine schematische Verkürzung, als Verstehensbrücke aber durchaus nützlich, von einem Schreiben „nach Kafka“ zu sprechen: nach Kafka, mit Goethe. Nicht gegen Kafka, der Handke, wie er noch 1979 sagte, „zeit meines Schreiblebens der Massgebende“ war, aber doch mit einer gewissen Distanz. Die Klassik, die sich Handke inzwischen selbst erarbeitet hat, ist krisengeboren und wird immer aufs neue krisenanfällig bleiben. Zugleich aber bietet sie Möglichkeiten der Besänftigung durch das Schöne, sie kann friedensstiftend wirken durch ein ruhiges, aufmerksames Erzählen jenseits von Kritik und Konflikt.
Die diversen Rückblicke, Studien, Theaterinszenierungen (vor allem des biographisch phantasierenden, zugleich geschichtsbewussten Dramas „Immer noch Sturm“) vor und zu Handkes 70. Geburtstags bekräftigen, was viele Leser schon länger und auch in medialen Kampfzeiten wussten: Handke ist mit den Jahren zum modernen Klassiker geworden.
Siegfried Unseld meint im Briefwechsel mit seinem Autor, ein Stück wie Über die Dörfer könne nicht auf einhellige Zustimmung bei der Kritik stossen, die Zeit sei für es noch nicht reif. Claus Peymann, der ursprünglich bei der Uraufführung Über die Dörfer Regie führen sollte, sprach unlängst von einem „Theater für ein neues Jahrhundert“; Handkes Stücke veränderten wie seine Prosa die Wahrnehmung.
Ein Klassiker des 21. Jahrhunderts, mit seiner neuartigen Friedensepik ebenso wie mit seiner unnachgiebigen Medienkritik, die dem globalen Andrang von Pseudoinformation und oberflächlicher Unterhaltung Paroli zu bieten versucht – so kann man Handke heute sehen. Dabei bleibt aufrecht, was Handke 1967 in den Slogan „Die Literatur ist romantisch“ fasste. Sie ist nicht nur, nicht immer klassisch. Man könnte sogar, liest man die grossen Epen des Spätwerks, von einem neuen Barock sprechen. Das alles zusammen macht Handke aus, und die Begriffe können wir am Ende getrost wegwerfen wie Leitern, die wir nicht mehr brauchen. Ganz im Sinne Handkes zitiert Höller dieses Wittgensteinsche Diktum.
Wo sind wir angelangt, wenn wir keine Leitern mehr brauchen? Im Reich der Freiheit, im Reich der Poesie… Oder, um bei Wittgenstein zu bleiben, im Reich der reinen Anschauung. Richtig, das klingt jetzt wieder nach Goethe.
Das Gespräch, in dem sich Claus Peymann zu Handke äussert, ist übrigens ein Beitrag zu einem schön gestalteten Buch über „Peter Handke und das Theater“, das zahlreiche Abbildungen, Interpretationen, Analysen und Interviews enthält, darunter ein Gespräch mit Jens Harzer, der in der Uraufführung von „Immer noch Sturm“ Gregor verkörperte, diese von Handke immer wieder abgewandelte Figur, Lichtgestalt der Wiederholung, die er aus seiner realen Familiengeschichte gewissermassen herausgeschält hat. Harzer gehört zu einer jüngeren Schauspielergeneration; leute wie Libgart Schwarz, Bruno Ganz, Claus Peymann oder Wim Wenders waren viele Wege gemeinsam mit Handke gegangen, in seiner Nähe oder an seiner Seite.
Es tut gut zu lesen, mit welcher Souveränität Harzer dem Werk Handkes gegenübertritt, indem er etwa die grossen Theaterstücke – „Über die Dörfer“, „Das Spiel vom Fragen“, „Immer noch Sturm“ – mit ihrem „wirklichen Weltentwurf“ von kleineren „Capriccios“ unterscheidet. (Man könnte heute im Rückblick auf die Sprechstücke die Frage stellen, ob nicht „Kaspar“ mit seiner Analyse von sozialen und sprachlichen Strukturen viel tiefer geht als die popig beschwingte „Publikumsbeschimpfung“.) Gregor erscheint im letzten grossen Stück Handkes als verdatterter Partisan, der sich in Kriegszeiten einer slowenischen Gruppe angeschlossen hat, von deren politischen Perspektiven aber nicht recht überzeugt ist. Harzer benennt diese beiden Kraftströme, die in Handkes Stücken und Erzählungen am Werk sind: sanfte und die aggressive Energie, Milde und Wut, entschlossener Entwurf und ständiges Hinterfragen, das auch und vor allem das Ich betrifft.
„Eine Geschichte“, sagt Harzer aus seiner Bühnenerfahrung heraus, „muss immer wieder einmal aufhören, damit sie weitergehen kann oder stocken. Das kann man alles in dem Stück unterbringen; die Tatsache, dass dieses Erzählen-Müssen und Erzählen-Wollen weitergeht, das erreicht über die Länge dieser vier Stunden dann einen allgemeinmenschlichen Punkt, der etwas Friedliches hat.“ Eine ähnliche Erfahrung habe ich 1982 als Zuseher der Inszenierung von „Über die Dörfer“ durch Wim Wenders in der Salzburger Felsenreitschule gemacht. Damals wohnte ich der zunächst von vielen, auch von der Literaturkritik, missverstandenen Geburt eines Klassikers bei.
Peter Handke, Siegfried Unseld
Der Briefwechsel
Hrsg. von Raimund Fellinger und Katharina Pektor.
Suhrkamp Berlin, 2012
798 S., geb.
CHF 53.90. EUR 39.95
ISBN 978-3-518-42339-4
Die Arbeit des Zuschauers.
Peter Handke und das Theater.
Hrsg. v. Klaus Kastberger und Katharina Pektor.
Salzburg und Wien, Österreichisches Theatermuseum
sowie Jung und Jung 2012
Lothar Struck
„Der mit seinem Jugoslawien“.
Peter Handke im Spannungsfeld zwischen Medien und Politik.
Leipzig, Ille und Riemer 2012
Hans Höller
Eine ungewöhnliche Klassik nach 1945.
Das Werk Peter Handkes.
Berlin, Suhrkamp 2013
Buchtipp:
Leopold Federmair
Die Apfelbäume von Chaville
Annäherungen an Peter Handke
Jung und Jung, Salzburg
CHF 29.90. EUR 22.
ISBN 978-3-99027-029.5
Wie nähert man sich Peter Handke? Durch eine kurze Allee bei Paris, an deren Ende das Haus des Schriftstellers steht, oder über den Königsweg genauer Lektüre. Der Essayist Leopold Federmair wählt für sein Buch beide Möglichkeiten. Er besucht Handke, sitzt redend mit ihm im Garten und macht diese Begegnungen zum atmosphärischen Beginn einer ebenso lakonischen wie genauen Auseinandersetzung. In sieben weiteren Texten umkreist Federmair zentrale Themen.
Es geht um die Kindheit und eine Herkunft zwischen den Kulturen, um den Krieg und das politische Engagement. Wie sehr Leben und Schreiben einander bedingen, macht Leopold Federmair klar, wenn er bis in die Mikrokosmen der Motive und der Sprache Peter Handkes vordringt. Die Aporien entgehen diesem Blick nicht: Handkes Werk entsteht aus Sanftheit und Zorn zugleich, es sucht die Leere der Landschaft, um von der Überfülle des Lebens zu erzählen, und die Einsamkeit, um von Gemeinschaft zu träumen.
„Als ich das erste Mal hierher kam, wartete Peter Handke im ‚Café des Hôtel des Voyageurs’ gegenüber vom Vorstadtbahnhof auf uns. Ich war überrascht, wie kurz die Reise vom Bahnhof Montparnasse dauerte. Das Treffen war erst für halb sieben vereinbart, der Abend noch fern, also fuhren wir – meine kleine Tochter und ich – weiter bis Versailles, spazierten dort im Schloss und im Garten herum, ehe wir nach Chaville zurückfuhren. Ich hatte Handke einen etwas früheren Zeitpunkt für das Treffen vorgeschlagen, doch dieses Ansinnen wie er fast mit Entrüstung ab: Er habe doch zu schreiben, eine solche Verkürzung seines Arbeitstages käme überhaupt nicht in Frage.
Im Café wurden wir dann von einer jungen Frau mit golden schimmernder Hautfarbe bedient; Brasilianerin, teilte mir Handke mit. Das Hotel kommt in ‚Mein Jahr in der Niemandsbuch’ vor, ich hatte brieflich den Vogelschlafbaum erwähnt, der im Buch eine gewisse Rolle spielt, und diese Erwähnung schien Handke gefallen zu haben. „Sie wollen den Vogelschlafbaum kennenlernen?“. Er winkte ab: „Das war einmal“. Die Vögel übernachteten längst woanders“.
So beginnt die launige Erzählung über Peter Handke, dessen Wirken Leopold Federmair auf mannigfaltigen Wegen nachgespürt und beschrieben hat, sodass er mit seinen Notizen und Notaten wie kaum ein anderer dazu prädestiniert ist, den bedeutungsvollen Briefwechsel Handke-Unseld (siehe oben) vorzustellen.