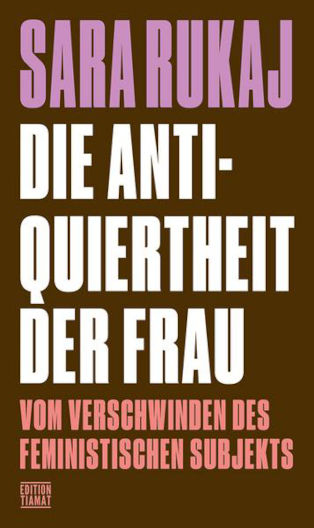

«Sara Rukaj: Die Antiquiertheit der Frau – Vom Verschwinden des feministischen Subjekts»
Von Ingrid Isermann
Ist der Feminismus überholt und im Zuge seiner Popularisierung zum symbolpolitischen Accessoire geschrumpft? Sara Rukaj beleuchtet in ihrem Buch die Bedeutung des Feminismus für Frauen, seine umstürzlerische Radikalität, die noch nicht entschieden sei.
Geschlechterverhältnis und Sexualität haben in den letzten fünf Jahrzehnten einen epochalen Liberalisierungsschub durchlaufen. Eine kurze Zeit, bedenkt man die Tausenden von Jahren, in denen Frauen keine Entscheidungsbefugnis über ihre Reproduktion hatten und ihre soziale Rolle entweder als Mutter oder jungfräuliche Tauschware, die nahtlos vom Vater auf den Ehemann überging, festgeschrieben war.
Die sexuelle Befreiung ist das historische Resultat der Frauen- und 68-er-Bewegung. Deshalb sei es wichtig, an die Zeit vor der Pille oder der strafrechtlichen Ahndung von unsittlichem Verhalten und Homosexualität zu erinnern, so die Autorin Sonja Rukaj. Religiöse Normen, die sexuelle Ausdrucksformen als gut (reproduktive Sexualität in der Ehe) oder schlecht (Homosexualität, Masturbation) einordneten, haben in der westlichen Hemisphäre des 21. Jahrhunderts an Bedeutung verloren.
Das Recht auf Selbstbestimmung, Mitspracherecht in der Politik, uneingeschränkter Zugang zu Bildung und qualifizierten Tätigkeiten, die Abschaffung des Paragrafen 218 in Deutschland und die Aufweichung des alten Scheidungsrechts sind nur einige verwirklichte Hauptforderungen der zweiten Frauenbewegung, die ihrer nunmehr gender- und queerfeministischen Nachfolgegeneration aber derart selbstverständlich sind, dass sie sich über die bisherigen Errungenschaften lieber ausschweigt und auf Abstand zu den Frauen früherer Tage geht.
Auch alte Begrifflichkeiten werden selbstbewusst abgelegt, die Rede von der Frau wird in Anführungszeichen geführt, wenn sie nicht gleich hinter dem Wortungetüm FLINTA (Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und -agender Person) zum Verschwinden gebracht wird, kritisiert Sara Rukaj. Der Genderismus wolle alle Differenzen benennen, nur die eine nicht, die Frau, in gewissen Kreisen wird die «Frau» in Anführungszeichen gesetzt, wenn sie nicht gleich als FLINTA, Co-Elternteil oder «Person mit Uterus zur Unkenntlichkeit nivelliert wird.
An die Stelle des feministischen Subjekts ist heute die «Performität» aller möglichen Identitäten getreten, mit denen gespielt und um die vielfältigsten Geschlechterpronomen gewetteifert wird. Stand der postfeministische Avantgardismus der Neunzigerjahre schon für den Niedergang der weiblichen Emanzipation, weil er Frauen nicht länger zur politischen Referenz- und Analysekategorie erheben wollte, radikalisieren sich seine heutigen Epigonen in diesem Punkt noch weiter, wie die Deutungsfehden um die angemessene Definition von Geschlecht zwischen Queeraktivisten und ihren radikalfeministischen Antipoden, die an der biologischen Fundierung des Geschlechtsbegriff festhalten.
Der Begriff «Frau»
Der Begriff der «Frau» hat die Frauenbewegung im weltweiten Kampf um Gleichstellung mehr als ein Jahrhundert lang geeint. Seine integrative Kraft als politischer Begriff war in der Schweiz am Frauenstreik 2019 noch zu spüren, als eine halbe Million Frauen auf die Strasse gingen, eine der grössten Mobilisierungen der Schweizer Geschichte. Ein Genderstern signalisierte, dass alle mitgemeint waren, auch mitdemonstrierende Männer.
Inzwischen heisst der Frauenstreik aber «Feministischer Streit», und auf der Webseite des Zürcher Komitees wird erklärt, dass alle «Flinta» mitgemeint sind, «Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre. Trans». In aktivistischen Kreisen spricht man heute in unpersönlichen Abkürzungen. War man früher geübt in der Neutralisierung von Personen als Trägern einer spezifischen Funktion, so lernen wir heute, sie zu sexualisieren. Bei Männern, die ungebrochen für den Normalfall stehen, vollzieht sich dieser Prozess verallgemeinernd und unter Absehung ihrer eigentümlichen Männlichkeit.
Frauen hingegen werden als relationales Gut betrachtet, gewertet und fein säuberlich dekonstruiert, bis nichts mehr von ihnen übrigblieb, oder wie es Jacques Lacan formulierte, «La femme n’existe pas». Auch Judith Butlers Dekonstruktion des biologischen und kulturellen Geschlechts zielt sonderbarerweise immer auf die Frau, so als gäbe es sie tatsächlich nicht oder nur als «schaurige Phantasie eines omnipotenten Patriarchats», so die Autorin.
Dass es sie eben doch gibt, zeigte Freud gerade am Konzept der Bisexualität, in der weibliche und männliche Eigenschaften ebenso durcheinandergeraten wie sexuelle Vorlieben. Dass geschlechtliche und psychosexuelle Grenzen aufgehoben werden können und der Trieb nicht eindeutig festgelegt ist, zeugt von der Potenz eines offenen Naturbegriffs, der sich auch bei Adorno, Horkheimer und Nietzsche findet: «Wer seine natürliche Basis abstreitet, kann weder denken noch sprechen».
Ein körperlos gedachtes Ich
Der im Netz zur Massenbewegung gewordene Gender- und Queerfeminismus will mehr: ein körperlos gedachtes Ich flexibel umprogrammieren oder, wie es in Wirtschaft, Werbung und Kulturindustrie heisst, nach Belieben neu erfinden.
Diese Naturverleugnung sei gleichwohl einer Naturgesetzmässigkeit unterstellt, von der die menschliche Psyche nicht loskommt: der Wiederkehr des Verdrängten. Erst Verdrängung schaffe Identität, umgekehrt liesse sich folgern, dass Identität, wo sie postuliert wird, auf Verdrängung beruht. Die Körpernatur ist dann nicht mehr nur sozial überformt, sie ist reine Sozialität geworden. Von den Verfechtern der Gender-Theorie wird sie vornehmlich auf der Sprachebene aufgefunden und so gleichsam entmaterialisiert. Die Sprache mag zur Bildung des Bewusstseins beitragen, sie kann sie jedoch nicht ersetzen.
Projektionsfläche queerer Omnipotenz
Zivilgesellschaftliche Sprachgewohnheiten und ein zum Götzen erhobener Identitätspluralismus sind Ausdruck einer um sich greifenden Ohnmacht und bestätigten gleichwohl Katharina Rutschkys These, dass die neue Frauenbewegung Symptom eines radikalisierten unglücklichen Bewusstseins ist, in das moderne Feministinnen deutlicher als je zuvor eingesperrt seien, schreibt Sara Rukaj.
Noch immer gilt das Frausein ihren vorgeblichen Fürsprechern nicht als anatomisches Schicksal, sondern als unliebsame Begleiterscheinung, die nunmehr als Projektionsfläche queerer Omnipotenz figuriert und über die man ganz ohne Rückbesinnung auf seine Körpernatur frei zu verfügen meint: als körperloses Geistwesen, das die Körperteile nach dem Baukastenprinzip seiner gewünschten Identität anpasst. Die Imagination eines «fluiden» und «gequeerten Körpers», der «omnipotent gesext (…) und gegendert werden könne, schrieb die Sexualwissenschaftlerin Sophinette Becker, ermögliche es künftig jedem, im Flux der Vielfalt zu schwimmen, ohne die leibliche und klinische Dimension dieser Begriffe zu erfassen. Neben der Frau ist auch die kritische Gesellschaftstheorie und Psychoanalyse zum Verschwinden gebracht.
Denn nahezu bewusstlos habe sich die feministische Nachfolgegeneration dem grenzenlos fluiden Kapital anverwandelt, das auf reale Frauen immer weniger angewiesen sei, so die Autorin. Sein Sprachrohr hat es in zeitgeistkompatiblen Influencern und authentischen Grossstadtnomaden gefunden, die den grossen Firmen weltweit die neuesten Versatzstücke für ein hippes und aufgeklärtes Feigenblatt liefern und auf ihren Blogs und Instagram-Kanälen an ihrer Kommodifizierung weiterarbeiten. Der Feminismus ist in den herrschenden Institutionen zum konformistischen Diversity-Management geschrumpft, das zunehmend auch in der öffentlichen Verwaltung, in Unternehmen, in der Werbung und in den Leitmedien propagiert wird. Ist das Potenzial universeller Emanzipationsbestrebungen erst ausgeschöpft, funktioniere die Diskriminierung der Frau wie eine paranoide Erwartung, die stets Erfüllung findet, wenn nur lange genug nach ihr gesucht werde. Die Frauenfrage wurde dem Staat überantwortet, der sie je nach Handlungs- und Finanzierungsspielraum als symbolpolitisches Fortschrittslabel integriert.
Verschwindende Körper
Seit einiger Zeit lässt sich in der Geschlechterforschung die Tendenz beobachten, die Vorgeschichte der eigenen Disziplin dadurch zum Verschwinden zu bringen, dass sie als Erbschaft beansprucht wird. Das postmoderne Subjekt soll sich immer wieder neu zusammensetzen als «non-binär, queer, femme, demi-, sapi oder asexuell», um einige der immer spezialisierteren Begriffskonstruktionen zu nennen. Für die Geschlechterforschung bedeutete dieser Wandel, dass die Kategorie Mann oder Frau, im Grunde die Kategorie Geschlecht überhaupt, nicht länger vorausgesetzt werden dürfe, auch nicht zu dem Zweck, daran anknüpfende Rollenmuster zu analysieren.
Sich in der Auseinandersetzung auf Ei- oder Samenzellen zu berufen, die mithin elementar für die menschliche Existenz und die bestehende Artenvielfalt sind, dies offen auszusprechen, führe zur Feindmarkierung, die nicht nur von Aktivisten ausgehe, sondern auch von jener wissenschaftlichen Disziplin, auf der das moderne Schöpfertum gründet.
Eine kleine Gruppe von Trans-Aktivistinnen beschimpfte die Schriftstellerin Joanne K. Rowling in den sozialen Netzwerken, nachdem sie sich in die britische Transgender-Debatte eingeschaltet hatte und den Begriff «menstruierende Personen» sarkastisch kommentierte, worauf sie von den Trans-Aktivistinnen als «Terf», als «trans-exclusionary radical feminist» betitelt wurde. Rowling konterte, Frausein sei kein Kostüm, wenn die Trans-Community fordere, von «menstruierenden Menschen» und «Personen mit Vulva» zu sprechen, sei das für viele Frauen entmenschlichend und erniedrigend. Rowling warnte vor der Erosion der «Frau» als politischer und biologischer Kategorie.
Feministinnen erkennen in dieser Haltung vor allem eine frauenfeindliche Tendenz.
Aufgrund des lautstarken Genderfeminismus untersucht die Autorin die Hintergründe sowie Motivationen und ihre verhärteten Fronten und fordert dazu auf, sich selbst den Sprachgebrauch genau anzuschauen.
Natürlich gibt es das soziale Geschlecht, oder viele soziale Geschlechter. Es gibt aber auch das biologische Geschlecht, als Grundmodell und Ursuppe zwei Geschlechter, Frau und Mann. Und dann Variationen. Es soll jede und jeder so leben können, wie er oder sie möchte. Das macht unsere Welt bunter und vielfältiger. Ob man sich nun entscheidet, Mann oder Frau zu sein, oder beides, oder gar nichts, obliegt der eigenen Person. Wozu sich darüber streiten?
Aber die Begrifflichkeiten Frau und Mann sind als Urmodell gesetzt. Was noch alles andere möglich ist, kann uns ja überraschen. Ich warte noch auf den ersten Kentaur, der Mensch als Pferd. Als Gorilla können wir ihm ja schon täglich begegnen. Nur die Sprache, die sollten wir nicht total verhunzen. Menschlichkeit in Ehren, Menschen sind wir alle, aber nicht alle gebären und nicht alle menstruieren und nicht alle haben eine Vulva. Das sind nur die Frauen, notabene! Im übrigen auch verständlich, wenn sich Männer eine Scheibe der Schönheit von Frauen abschneiden möchten. Unterdrückte Minoritäten aller Couleur meldet euch!
Übrigens, Sterne sehe ich lieber am Himmel als in einem Text, den sie zerstückeln. Eine Gemeinsamkeit haben die nonbinären Identitäten mit den Feministinnen doch: sie erleben nun das, was Frauen in tausendjähriger Geschichte bisher als Ablehnung und Gewalt erfahren haben. Ob ihnen das bewusst ist?
Sonja Rukaj, 1992 in Wien geboren, lebt in Frankfurt am Main und hat Literatur, Philosophie und Psychologie studiert. Als freie Autorin beschäftigt sie sich mit Antisemitismus, Feminismus und Ideologiekritik. Sie schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Neue Zürcher Zeitung, Jungle World, Welt und Die Zeit.
Sara Rukaj
Die Antiquiertheit der Frau
Vom Verschwinden des feministischen Subjekts
Edition TIAMAT, Verlag Klaus Bittermann
Paperback, 200 S., CHF 28.90
ISBN 978-3-893202867

