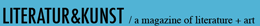Der zweite Teil der Biographie von Julian Schütt: «Max Frisch. Biographie einer Instanz», Suhrkamp Verlag, Berlin 2025.

Die Dichterin Ingeborg Bachmann, nach ihr sind die Bachmann-Literaturtage in Klagenfurt benannt.

Buchpräsentation Schauspielhaus Zürich, 23. Juni 2025, v.links: Lukas Bärfuss, Julian Schütt, Carol Schuler.

Julian Schütt. Biographie Teil 1: Max Frisch 1911-1954. Biographie eines Aufstiegs, Taschenbuch Suhrkamp, 2012

Max Frisch. Stiller. Taschenbuch Suhrkamp, 1973

Max Frisch. Homo Faber. Taschenbuch Suhrkamp, 1977

Max Frisch. Mein Name sei Gantenbein. Taschenbuch Suhrkamp, 1975

Max Frisch. Montauk. Taschenbuch Suhrkamp, 1981
«Neue Max Frisch-Biographie: Eine Chronik der Obsessionen der Verwandlungen»
Von Ingrid Isermann
Im zweiten Teil seiner Biographie Max Frisch. Biographie einer Instanz. 1955-1991 zeigt Literaturwissenschaftler Julian Schütt auf, wie Max Frisch zu einer literarischen und politischen Instanz wurde. Einer Instanz der Relevanz, wie sie heute fehlt.
Nach dem ersten Teil seiner Biographie Max Frisch. Biographie eines Aufstiegs. 1911-1954 aus dem Jahre 2011, beleuchtet Julian Schütt im zweiten Teil Max Frisch. Biographie einer Instanz die vielfältige Vita von 1955-1991 und Frischs Obsessionen zur Identität und Politik.
Aufgrund unveröffentlichter Briefwechsel, Notizbücher sowie Gesprächen mit Weggefährten zeigt Schütt die eminent wichtige Bedeutung der Beziehungen zu Partnerinnen auf, die mit Frisch verbunden waren und seine Entwicklung und sein Werk beeinflussten, wie in Stiller (1954; der Roman kommt neu verfilmt in einer SRF-Koproduktion 2025 in die Kinos), Homo faber (1957) oder Mein Name sei Gantenbein (1964).
Vom Architekten zum Schriftsteller
Der junge Max Frisch empfand bürgerliche und künstlerische Existenz als unvereinbar und war lange Zeit unsicher, welchen Lebensentwurf er wählen sollte. Nach einem abgebrochenen Germanistik-Studium und ersten journalistischen und literarischen Arbeiten absolvierte er 1936-40 ein Studium der Architektur an der ETH Zürich und betrieb 1944-55 ein Architekturbüro. 1940 gewinnt er die Ausschreibung für das Freibad «Letzigraben» in Zürich mit einer grosszügigen Gartenanlage, das 1947 bis 1949 erbaut wurde. 1947 lernt Frisch neben Peter Suhrkamp den Dramatiker Bertolt Brecht kennen, der ihn 1948 in Zürich auch auf dem Bauplatz besucht. Die Anlage steht heute als Max Frisch-Bad in Zürich unter Denkmalschutz und wurde 2006 bis 2008 saniert.
Im Herbst 1950 erschien das erste Suhrkamp-Verlagsprogramm, darin Frischs Tagebuch 1947-1949, Benjamins Berliner Kindheit um 1900, Essays von T.S. Eliot, Hesses Glasperlenspiel und Späte Prosa von Shaw. In Frischs Tagebuch steht der Satz: «… irgendwie ist man immer ein Ausländer, nämlich wenn man beschreibt, was man nicht persönlich erlebt hat», und: «… man ist sehr rasch ein Emigrant». Andererseits konnte er sich über die Schweizer Bravheit und Biederkeit mokieren, auch bei sich selbst.
Nach dem Erfolg seines Romans Stiller (1954) entschied sich Frisch 1955 für ein Leben als freier Schriftsteller und trennte sich von Beruf und Familie, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Sein Roman Stiller ist die Geschichte eines Mannes, der seine Identität verleugnet: „Ich bin nicht Stiller“, um Abstand von seinem missglückten Leben zu finden. Die Identitätsproblematik spielt auch in späteren Romanen von Frisch eine Schlüsselrolle.
Homo faber handelt von der Geschichte des Ingenieurs Walter Faber, der Roman entstand Mitte der 50er-Jahre, wo Wolkenkratzer in New York aus dem Boden schossen und Techniker schwindelerregende Brücken bauten. Eine Verkettung unberechenbarer Zufälle erschüttert Fabers rationales Weltbild; in der mexikanischen Wüste überlebt er einen Flugzeugabsturz, auf einer Schiffsreise nach Europa verliebt er sich in Sabeth, eine junge Frau, die seine Tochter sein könnte. Er begleitet sie nach Athen zu ihrer Mutter, seiner früheren Partnerin, die ohne sein Wissen ein Kind von ihm erwartete. Auf dem Wege dorthin verunglückt Sabeth tödlich.
Frisch verarbeitet die Bedeutung des Zufalls oder Schicksals als Gegensatz von Technik zu Natur und Mythos wie ein antikes Drama. Der lakonisch neuartige Stil einer Reportage erinnerte mich an Hemingway, Frisch nannte den Text nüchtern einen „Bericht“. Das Buch wurde in 25 Sprachen übersetzt und wird häufig sowohl als literaturwissenschaftliches Lehrmaterial als auch im Schulunterricht verwendet.
Frischs Theaterstück Don Juan oder die Liebe zur Geometrie, in der er männliche Rollenspiele hinterfragte, wurde nach der Uraufführung 1952 in Hamburg und Berlin in einer neuen Version am 12. September 1962 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg uraufgeführt. Nach seinen Parabeln Biedermann und die Brandstifter und Andorra wurde es zum dritterfolgreichsten Theaterstück Frischs mit über hundert Aufführungen an deutschsprachigen Bühnen. Max Frisch machte sich also schon früh einen Namen auch in Deutschland und in der deutschsprachigen Literatur- und Theaterszene.
Eine Art von Paar
Max Frisch hat von 1952 bis 1958 eine Beziehung mit der verheirateten Madeleine Seigner-Besson, deretwegen er sich 1954 von seiner langjährigen ersten Ehefrau Gertrud von Meyenburg (1942-1959) und drei Kindern getrennt hatte.
Die Beziehung zur österreichischen Dichterin Ingeborg Bachmann (1926-1973), die von 1958 bis 1963 dauerte, steht im Fokus der Biographie, zu der der veröffentlichte Briefwechsel zwischen Frisch und Bachmann beitrug (Wir haben es nicht gut gemacht, Suhrkamp 2022).
Als der 48-jährige Max Frisch in Paris mit der 32-jährigen Ingeborg Bachmann zusammentrifft, wo sein Theaterstück Biedermann und die Brandstifter im Théâtre des Nations Premiere feiert, hat sie eine Liebesgeschichte mit dem Lyriker Paul Celan beendet und ist mit dem französischen Journalisten Pierre Évrard liiert.
Es ist der 3. Juli 1958, Ingeborg Bachmann trifft Frisch eine Stunde vor der Aufführung in einem Café, er hatte zwei Tickets für den Balkon, doch sie kam „gekleidet für eine Loge“. Frisch meint, sie müsse sich das Theaterstück nicht anschauen, er lädt sie stattdessen zum Essen ein und sie bummeln durch Paris, den Morgen danach verbringen sie in den Markthallen Les Halles, wo es früh Kaffee gab. So hat es Frisch später in Montauk und im Tagebuch 1966-1971 geschildert («… Paris hat immer etwas von einer früheren Geliebten, (…) Parfum-Kauf bei der Vendôme, Proben im Theater, die Begegnung mit Samuel Beckett, eine Nacht in den Hallen, als Paar zwischen morgendlichen Metzgern mit Schürzen voll Blut».
Am Donnerstag hatten sie sich in Paris kennengelernt, am Freitagmorgen ging er zurück ins Hotel, um etwas zu schlafen. Im Laufe des Nachmittags suchte Ingeborg Bachmann ihn im Hotel auf, niedergeschlagen, erschöpft von der Auseinandersetzung mit ihrem französischen Geliebten, den sie in der Nacht warten liess, «ihr Schrecken über das Leid, das sie angerichtet hat; denn sie liebt ihn, sie ist seinetwegen in Paris».
Beide sind schon in einer Beziehung und so lässt sich das Hin und Her in den ersten Briefen erklären, die von Abschied und Verlust sprechen, zwischen Anfang und Ende, Abstossung und Anziehung. Aufgrund dieses Briefwechsels sind auch die wechselvollen Stationen dokumentiert, wie die beidseitigen Zweifel an einer Partnerschaft: «Du trittst in mein Leben, Ingeborg, wie ein langgefürchteter Engel, der da fragt Ja oder Nein … Du bist ein Meertier, das nur im Wasser seine Farben zeigt. Und ich bin glücklich und ratlos und zu feig, über die Stunde hinaus zu denken. Ich will den Sommer mit Dir».
Und dank des Briefwechsels lässt sich nun auch belegen, so der Biograph, dass es für das, was zwischen Frisch und Bachmann stattfand, kein anderes Wort als Liebe gibt. Am 5. Oktober 1958 schrieb sie an ihren «Liebsten», sie denke ununterbrochen an ihn, «und zugleich weiss ich nicht, was in einen Brief hineingeht davon. Das Glück und die Ängste, die allernächste Zukunft und die fernere». Sie staunte über die «Ungeheuerlichkeit, dass wir nun miteinander leben wollen», und fügte zuletzt hinzu: «Ich liebe Dich!»
Wenige Wochen später schrieb ihr ein seliger Max Frisch, dass er eine Wohnung gefunden habe, unmittelbar am Zürichsee, in der Nähe seines Wohnortes Männedorf, wo er in einem Bauernhaus nach der Trennung von seiner ersten Frau lebte.
Das Haus am Langenbaum in Uetikon, gleich beim Bahnhof, eine halbe Stunde Zugfahrt von Zürich entfernt, war ein stattliches Landhaus, erbaut 1634, gut instand gehalten, mit Garten und mit Sicht auf den See.
Frisch und Bachmann waren von öffentlichem Interesse, nicht erst seit sie 1958 wie zwei Kometen aufeinanderprallten. Ingeborg Bachmann ist, nach ihrem Studium der Philosophie, Psychologie, Germanistik und Promotion als Dr. phil., der Star der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur, sie gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts seit ihrem literarischen Debüt mit den Gedichtbänden «Die gestundete Zeit» und «Anrufung des Grossen Bären». Ihr zu Ehren wird seit 1977 jährlich der Ingeborg-Bachmann-Preis in ihrer Geburtsstadt Klagenfurt verliehen. 1954 ist ihr Porträt als gefeierte Dichterin auf dem Spiegel-Titelcover, ein Jahr nach Max Frisch, der 1958 den renommierten Georg-Büchner-Preis erhält. Sie pflegt die Kontakte auch später zu ihren eigenen Kreisen, wie zu der berühmten literarischen Gruppe 47, wo sie 1953 zuerst auftrat, oder dem deutschen Komponisten Hans Werner Henze, für den sie ein Libretto für Der Prinz von Homburg nach den Texten von Heinrich von Kleist schrieb, und dessen Haus in Neapel sie öfters als Zufluchtsort benutzt.
Frisch tendiert zu einer festeren Beziehung, macht ihr einen Heiratsantrag, doch Bachmann will unabhängig bleiben. Als Ingeborg Bachmanns 1959 mit dem Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger begonnene Affäre schliesslich zum «Venedig-Vertrag» führt, wird das Bachmann-Frisch-Verhältnis als offene Beziehung definiert. Die beidseitigen Ambivalenzen bildeten jedoch die grösste Konstante im Verlauf ihres oft nicht gemeinsamen Lebens, da beide wochenlang auf Reisen sind.
Der gemeinsame Wohnsitz ab 1960 ist auf Wunsch von Ingeborg Bachmann in Rom, die Wohnung oberhalb der Villa Borghese ist luxuriös eingerichtet, dazu gehört auch eine Haushälterin, die die vielen Gäste und Schriftstellerkollegen des Paares bewirtet. Als die junge deutsche 24-jährige Literaturstudentin Marianne Oellers, die in Rom 1962 ihren Freund, den Dramatiker und Villa Massimo-Stipendiaten Tankred Dorst besucht und mit ihm an einer Party bei ihnen auftaucht, ist Max Frisch von ihr fasziniert. Er umwirbt die junge Frau, die achtundzwanzig Jahre jünger ist als er und beginnt eine Romanze mit ihr. Bachmann war zu einer Lesung nach München gereist, während Frisch auf ihre Anregung hin Marianne Rom zeigt.
Bachmann nimmt die Liaison nicht ernst und ist überrascht, als es Frisch doch ernst meint; seine Hörigkeit sei aufgebraucht, lässt er verlauten. Es ist der Beginn des Endes ihrer mehr als vierjährigen Partnerschaft; die 36-jährige Ingeborg Bachmann erleidet einen Zusammenbruch und lässt sich im Dezember 1962 in die Bircher-Benner-Klinik in Zürich einweisen, wo Frisch sie vor seiner Abreise mit Marianne in die USA noch einmal besuchen kommt. Im Zimmer stehen 35 rote Rosen, doch die hat ihr nicht ein Verehrer, wie Frisch annimmt, sondern sie sich selbst geschickt.
Die Agonie wird Ingeborg Bachmann begleiten, – 1963 zog Bachmann mit einem einjährigen Artist in Residence-Stipendium der Ford Foundation nach Berlin, wo sie bis 1965 blieb, – nicht zuletzt, weil sie sich in Frischs Gantenbein-Roman (1964) blossgestellt sieht. Auch hier geht es Frisch um Identität, der Erzähler erfindet für sich nach einer gescheiterten Beziehung wechselnde Identitäten, um der eigenen Erfahrung aus unterschiedlichen Perspektiven nachzuspüren. Er stellt sich blind, um mehr zu sehen. Frisch schickt Bachmann das Manuskript, in dem sie einige Korrekturen vornimmt; als er ihr ein Exemplar des Buches sandte, verweigert sie die Annahme. 1964 erhält Ingeborg Bachmann den Büchner-Preis, 1968 den grossen Österreichischen Staatspreis für Literatur.
In ihrem einzigen Roman Malina (1971) erforscht sie ihre existenzielle Situation als Frau und Schriftstellerin, das Buch erscheint kurz vor ihrem tragischen Tod in Rom 1973 mit 47 Jahren infolge eines Brandunfalls. 1991 wurde der Roman unter dem gleichnamigen Titel verfilmt.
Schaffensjahre in Berzona, Berlin und New York
1964 erwirbt Max Frisch in Berzona im Tessin einen Rustico, den er umbaut, wo auch die spätere Erzählung Der Mensch erscheint im Holozän (1979) entstand, 1992 von Heinz Bütler verfilmt. Ende 1972 kaufte Max Frisch zudem eine Wohnung in Berlin in der Sarrazinstrasse, in die das Ehepaar Frisch im Februar 1973 einzog. Marianne ist als literarische Übersetzerin tätig, durch sie lernte Frisch eine neue Generation von Schriftstellern kennen, u.a. Peter Bichsel, Adolf Muschg, Paul Nizon, Jörg Steiner, Jürg Federspiel. In Berlin entwickelte sich ein neuer Freundeskreis mit u.a. Uwe Johnson, Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger, Lars Gustafsson, in Ost-Berlin mit u.a. Jurek Becker, Günter Kunert, Gerhard und Christa Wolf.
Von 1968 bis 1979 ist Frisch mit Marianne verheiratet. Die Ehe wird 1979 geschieden, nachdem es bereits 1974 zum Zerwürfnis gekommen war, wo Frischs Erzählung Montauk und die darin verarbeiteten Erlebnisse Frischs eine Rolle spielten.
Auch Max Frisch konnte über seine Zeit mit Ingeborg Bachmann nicht hinwegkommen, er widmete ihr ein Kapitel in seiner Erzählung Montauk (1975), die ebenfalls verfilmt wurde (Rückkehr nach Montauk, 2017). Ein Kapitel seines Lebens, das ihn nie losliess, wo er bemerkte: «Ich muss wissen, wen ich liebe». Sicher sei er sich bei Frauen nie, schrieb er in Homo faber. Mit den existenziellen Fragen in seinen Tagebüchern von Leben und Tod stellte er sich selbst infrage wie auch seine Unsicherheiten und Zweifel am eigenen Schaffen.
In Montauk erzählt der 64-jährige Frisch offen autobiographisch wie nie zuvor von seinen Beziehungen zu u.a. Ingeborg Bachmann, Marianne Frisch-Oellers und zur amerikanischen 32-jährigen Verlagsmitarbeiterin Alice Carey (Lynn), mit der er während seines Aufenthaltes in New York im Frühling 1974 eine kurze Liaison begann, die ihn zu seinem Spätwerk Montauk inspiriert hatte.
In seinem Nachlass wurde später ein Manuskript gefunden, das, herausgegeben und mit einem Nachwort von Peter von Matt, im Suhrkamp-Verlag erschien: «Entwürfe zu einem dritten Tagebuch» (2010). Darin setzt sich Frisch mit „New York als Herausforderung“ auseinander: «New York als Wallfahrtsort sozusagen über drei Jahrzehnte hin – und jetzt besitze ich dort eine sogenannte Loft, endlich so weit eingerichtet, dass man darin wohnen kann, hocke draussen auf der eisernen Feuertreppe im fünften Stock und kann es mir nicht verhehlen: Wie dieses Amerika mich ankotzt! LOVE IT OR LEAVE!»
An anderer Stelle vermerkt er im dritten Tagebuch: «Amerika (USA) ist im Grunde nicht kriegerisch, sondern lediglich kommerziell: Krieg als die Fortsetzung des Geschäftes mit anderen Mitteln». Und: «Was unsere amerikanischen Freunde erwarten: ein Wunder! – sie wollen gefürchtet werden und geliebt zugleich. Wenn uns das nicht gelingt, so empfinden sie es als Anti-Amerikanismus. (…) Es gibt in Amerika alles – nur eins nicht: ein Verhältnis zum Tragischen».
In den 80er-Jahren werden Frisch und Carey nochmals ein Paar, drei Jahre dauert ihre Verbindung. Frisch erwirbt ein Loft in New York, viel Zeit verbringen sie auch in seinem Haus in Berzona nach der Scheidung von Marianne. Nachdem sie sich von Frisch getrennt hat, zieht sich Carey aus der Verlagswelt zurück und wird Yoga-Lehrerin. Sie lebt heute in North Carolina/USA.
Eine kritische Instanz
Das meint man alles schon zu wissen, auch ein kürzlicher Spielfilm (Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste; Margarethe von Trotta, 2023) nahm sich ihrer komplizierten Beziehung an, die jedoch im Briefwechsel Frisch-Bachmann komplexer zur Sprache kommt.
Und doch ziehen sich die Lebenslinien der Protagonisten in aktuelle Politdiskussionen hinein, seien es die Demokratie bedrohende Autarkien, Eingriffe von u.a. Tech-Milliardären und KI in die Politik oder die auch heute heiss diskutierte Geschlechterfrage.
In der Suche nach Wahrheitsfindung waren Frisch und Bachmann ihrer Zeit voraus. Ingeborg Bachmann schrieb: „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“. Max Frisch: «Gerade die Unverbindlichkeit ist, wie wir wissen, die weitaus allgemeinste Art von Mitschuld». Ihn beschäftigten Identität und Reflexionen über die Frage wer bin ich, ein Leben lang: „Es ist nicht die Zeit für Ich-Geschichten. Und doch vollzieht sich das menschliche Leben oder verfehlt sich am einzelnen Ich, nirgends sonst“. (Aus: Mein Name sei Gantenbein, 1964).
Frisch prägte auch die politischen Debatten in der Schweiz und wird in der Öffentlichkeit als engagierter Intellektueller zu einer kritischen Instanz. Seine Bücher, u.a. Wilhelm Tell für die Schule (1971) und das Dienstbüchlein (1974) wurden Bestseller. Kurz vor seinem Tod kehrte er mit Jonas und sein Veteran 1989 in der Theaterfassung von Schweiz ohne Armee? Ein Palaver noch einmal zur politischen Botschaft auf die Bühne zurück.
2015, lange nach Frischs Tod 1991, wurde Ignoranz als Staatsschutz? erstmals veröffentlicht, man staunte, wie Frisch sich empören konnte über die staatliche Überwachung durch die Fichen-Affäre; in der heutigen digitalen Welt gibt man viel intimere Daten freiwillig preis und nimmt die Überwachung durch fremde Staaten und Konzerne wie Google oder Meta in Kauf und ist allenfalls nach Frischs Fichen-Collage verblüfft über die eigene Ignoranz.
Frischs Mahnung vor Demokratien, die Aufklärung und Widerstand misstrauen und sie einschränken oder verbieten, ist heute nicht weniger aktuell, wie nicht nur ein Blick nach Amerika zeigt, sondern auch in eigene Gefilde. In den 80er-Jahren war es noch möglich, die Spannungen zwischen Demokratie, Kapitalismus und Freiheit zu negieren. Man konnte den schlanken Staat, schlank durch Privatisierung, propagieren und gleichzeitig die Rückkehr zum autoritär-starken und nationalistischen Staat verlangen.
Die Folgen waren gleich, weil im schlanken wie im starken Staat demokratische Politik, Medien und Kultur schwach und unbedeutend sein sollen, reduziert auf die „Heiterkeit der Post-Moderne“, wie Frisch kritisierte, und nur die Wirtschaft würde wirklich frei bleiben. Vielleicht wohl auch einer der Gründe, warum die SVP die bilateralen Verträge mit der EU so ablehnt, die auch der Wirtschaft Regeln auferlegt. Oder die Einschränkung der SRG durch die „Halbierungs-Initiative“, wie sie die SVP fordert. Der ökonomische Neoliberalismus will über oder jenseits der Politik stehen oder gleich das Land übernehmen. Das sind bis heute die neuralgischen Punkte, je autoritärer Staaten (auch in Europa) auftreten.
Konstellationen zu «Homo faber»
Die umfangreiche Biographie ist akribisch und leichtfüssig flüssig geschrieben, man kommt den Bezugspersonen in den verschiedenen Lebensabschnitten in diesem Lebensroman Frischs nahe, u.a. auch Karin Pilliod, der Tochter von Madeleine Seigner und letzter Lebensgefährtin Frischs.
Im Frühjahr 1983 hatte Max Frisch sich endgültig von Alice Carey getrennt und lud Karin Pilliod zu sich nach Berzona ein, die von ihrem Ehemann Philippe Pilliod geschieden war. (1985/86 führte Frisch in Berzona und Zürich ein mehrstündiges Gespräch mit Philippe Pilliod über sein Leben und das Alter. DVD, Suhrkamp Verlag).
Karin fühlte sich sofort zuhause in Berzona, liebte die Gartenarbeit und die Stille als wohltuenden Kontrast zu ihrer Tätigkeit als Kindertherapeutin. Kaum waren sie ein Paar, präsentierte er Karin Pilliod als die „jugendliche Erscheinung“, die einst Homo faber „verursacht“ habe. Karin war 48 und damit genau in dem Alter, in dem ihre Mutter Madeleine Seigner gewesen war, mit der er eine Beziehung hatte und eine Reise nach Athen unternahm, als Homo faber entstand. Frisch fragte sich in jenem ersten Sommer mit Karin, ob ein Fluch darauf gelegen habe, die prekäre Konstellation beschäftigte ihn. Volker Schlöndorff, der später 1991 an der Verfilmung des Romans arbeitete, wurde eingeweiht, Karin sei das Vorbild von Sabeth gewesen.
Homo faber spielt auch in die Beziehung mit Käte Rubensohn hinein, die jüdische Freundin, die von ihm nicht geheiratet werden wollte, nur weil sie in der Nazizeit gefährdet war. Sie kehrt sinnbildlich wieder als Hanna in Homo faber, erscheint auch in Andorra und Montauk. Als Frisch Käte Rubensohn spät im Leben wiedertraf, wollte man den gemeinsamen Briefwechsel veröffentlichen. Dazu kam es nicht mehr, Frisch hatte ihre Briefe an ihn aus den 30er-Jahren vernichtet. Karin Pilliod war das Vorbild der jüdischen Sabeth gewesen, der Tochter Hannas (Käte) und des Erzählers Max Frisch. So hatte sich ein Kreis geschlossen.
Der Spielfilm Homo faber kam 1991 in die Kinos, der fast 80-jährige Max Frisch bekam den Film noch kurz vor seinem Tod als Preview zu sehen und meinte, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten, würde er vielleicht noch einen anderen Schluss für die Geschichte gefunden haben.
Schwierig war es besonders für Madeleine Seigner, noch zu Weihnachten 1982 hatte er ihr geschrieben: „Ich denke öfter an Dich, als ich es zeige; weil ich nicht weiss, was es zu sagen gibt, schreibe ich nicht“. Die Nachricht in Frischs Beziehung mit ihrer Tochter löste eine „Revolte“ in Madeleine aus, zumal es nicht die erste unliebsame Überraschung war, die sie mit ihm erlebte. Wie 1958, ein Vierteljahrhundert früher, als er sie wegen Ingeborg Bachmann verlassen hatte, zog sie sich zurück, ohne sich ganz von ihm abzukehren.
Auch hier scheinen Parallelen auf, als sich Frisch 1962 von der 36-jährigen Bachmann trennte, um eine Beziehung mit der 24-jährigen Marianne Oellers einzugehen. Wollte Frisch sich selbst und dem Alter entfliehen, indem er sich einer bedeutend jüngeren Frau zuwendete, was sich später mit Alice Carey wiederholte, immer noch einmal von vorn zu beginnen?
In seinem Theaterstück Biografie: Ein Spiel, das 1967 entstand, am 1. Februar 1968 im Schauspielhaus Zürich unter der Regie von Leopold Lindtberg uraufgeführt, wird die Frage der Biografie durchdekliniert. «Ich probiere Geschichten an wie Kleider», hatte er im Gantenbein-Roman geschrieben.
Seit seinem 22. Lebensjahr, so Frisch, habe er nie ohne Frau gelebt, eine Frau als Bezugsperson. Das sei in seinen Werken nicht anders: die Frau als Bezugsperson, getragen von den männlichen Erwartungen und ebenso davon belastet. Es sei eine „Sucht des Mannes“, die Frau verstehen zu wollen, zugleich jedoch ein Fluch. «Will die Frau, wenn sie geliebt wird, denn interpretiert werden? Irgendwann einmal kommt die Antwort: Ich bin nicht hier, um Deine Erwartungen zu erfüllen».
Leben wie im Exil
Gleichzeitig mit der neuen Lebenspartnerin fand der 72-jährige Max Frisch eine neue Unterkunft in Zürich, wo er nun leben wollte „wie in einem Exil“, wie er sagte, am Stadelhofen, in der Nähe von der legendären Kronenhalle, Kinos und Restaurants. Karin hatte eine Wohnung am Predigerplatz und ihren Arbeitsort. Nur übers Wochenende wohnten sie zusammen, was Frisch für eine weise Entscheidung hielt. Sie unternahmen zusammen Reisen nach Venedig, Marbella, Ägypten, Rom und 1989, im Jahr des Mauerfalls, letztmals auch nach Manhattan NYC.
Mitte der Achtzigerjahre fehlte ihm plötzlich die Luft zum Atmen, es waren Asthma-Attacken, die ihn in den Ferien in Südspanien überfiel. Wieder war er ein Notfall und brauchte Infusionen, von seinem Hotelzimmer in Malaga blickte er nach Gibraltar, aufs Meer und Atlasgebirge. Die schweizerische Rettungsflugwacht flog ihn nach Zürich zurück. Seine Gesundheit wurde brüchig, die Lunge war löchrig, ein Emphysem war die Folge des Rauchens, von dem er sich nun zu trennen hatte. Tatsächlich sah man ihn auch auf Fotos selten ohne Pfeife. Das Asthma attackierte ihn auf der Treppe zum Dogen-Palast in Venedig, als er dort 1985 Karins 50. Geburtstag feiern wollte.
Den Tod zu verdrängen, gelang nicht mehr. Er hatte Metastasen in den Lymph-Gefässen; ein letztes Mal hielt er sich in Berzona im Tessin auf. Der Dramatiker Friedrich Dürrenmatt (*1921), sein schwierigster Freund, hatte ihm einmal gesagt, – Frisch habe „seinen Fall zur Welt gemacht“, während Dürrenmatt „die Welt zu seinem Fall mache“ -, kam ihm zuvor und starb am 14. Dezember 1990 in Neuchâtel.
Karin Pilliod sollte seine letzte Erklärung vorlesen, er hatte die Bestattungsfeier in der Kirche St. Peter minuziös selbst geplant. Max Frisch starb am 4. April kurz vor seinem 80. Geburtstag am 15. Mai 1991 unter grosser in- und ausländischer Anteilnahme in Zürich.
Und schliesslich wird in der Biographie von Julian Schütt erstmals bekannt, dass Frisch in seinen letzten Lebensmonaten noch seine Pflegerin heiraten wollte, auch in diesem letzten Abschnitt noch auf einen ewig jungen Anfang setzte, dem ein Zauber innewohnt, wie es Nobelpreisträger Hermann Hesse ausdrückte. Treu blieb sich Frisch bis zuletzt als Verwandlungskünstler mit seiner Liebe zur Geometrie und zur Literatur – war er im Grunde vielleicht doch ein verkappter Romantiker?
Der in Millionenauflage meistgelesene und vielfach ausgezeichnete Schriftsteller der Schweiz Max Frisch ist ein zeitgenössischer moderner Klassiker – viele seiner Theaterstücke wie «Biedermann und die Brandstifter» oder «Andorra» werden auch gegenwärtig auf internationalen Bühnen gespielt.
Das auch zeitgeschichtlich fesselnde Porträt von Julian Schütt lässt einen Max Frisch jenseits von Klischees entdecken, der von sich sagte, er habe als Autor «mit Leben bezahlt». Diese Biographie lädt dazu ein, Max Frisch und sein faszinierend vielschichtiges Werk, das sich immer noch taufrisch liest, mit seinen Bezügen zum aktuellen Zeitgeschehen neu zu entdecken.
Julian Schütt, *1964, promovierter Literaturwissenschafter, war Literaturredakteur u.a. beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF und Mitglied der Kritikerrunde der Sendung «Literaturclub». 1998 konzipierte er die erste grosse Max-Frisch-Ausstellung, die in München, Berlin, Frankfurt am Main und Zürich gezeigt wurde. 2011 erschien der erste Band seiner Frisch-Biographie unter dem Titel «Max Frisch. Biographie eines Aufstiegs. 1911-1954». Julian Schütt lebt als Journalist und Autor in Zürich.
Julian Schütt
Max Frisch. Biographie einer Instanz 1955-1991.
Suhrkamp, Berlin 2025
Hardcover, 706 S., CHF 49.90
ISBN 978-3-518-43243-3