
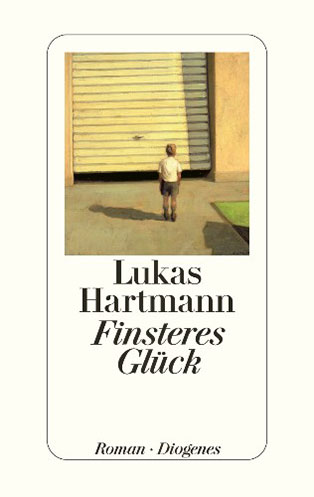


«Plädoyer für Solidarität»
Von Rolf Breiner
Der Berner Autor Lukas Hartmann lieferte 2010 die literarische Vorlage. Stefan Haupt («Der Kreis») hat dessen Roman «Finsteres Glück» packend verfilmt. Seine Frau Eleni verkörpert in dem Drama eine alleinerziehende Mutter zweier Töchter und Psychologin, die sich engagiert und beherzt um einen achtjährigen Knaben bemüht, der bei einem Autounfall seine Familie verloren hat. Wir sprachen mit Lukas Hartmann über Verfilmungen, Familie und finstere Momente.
«Der Anruf kam nachts um halb elf. Millionen von Menschen hatten sich mittags geschwärzte Gläser vor die Augen gehalten. Sie wollten die Sonnenfinsternis sehen, die bei uns partiell war, im Elsass und in Süddeutschland aber total». So beginnt Lukas Hartmanns Roman über Familienkonflikte mit dem tiefgründigen Titel «Finsteres Glück». Höllische Gestalten, als seien sie der Hand des Malers Hieronymus Bosch entsprungen, bevölkern die ersten Filmbilder, bis die Kamera eine trauernde Mutter, leidende Menschen und Jesus am Kreuz erfasst. Es handelt sich um den berühmten Isenheimer Altar des Künstlers Matthias Grünewald. Die Bildtafeln besagten Altars stehen heute in Colmar, im Museum Unterlinden.
Aber das erfahren wir später, als die Psychologin Eliane Hess (Eleni Haupt) ein Paket mit Broschüren auspackt. Seit Jahren hat sie sich mit den Altarbildern beschäftigt und nun ein Buch darüber verfasst. Das Museum in Colmar ist kaum das Ziel der Familie Zanini, wohl aber ein guter Standort im Elsass, um besagte Sonnenfinsternis im Spätsommer 1999 zu beobachten.
Doch dann überschlagen sich die Ereignisse beziehungsweise die Bilder im Film. Ein Auto nimmt im Tunnel Fahrt auf. Ein heilloses Durcheinander. Crash. Nur einer der fünf Insassen überlebt. Der achtjährige Yves, fast unverletzt, ist Vollwaise. Die Psychologin Eliane kümmert sich im Zürcher Waid Spital um den Knaben und gewinnt sein Vertrauen. Wie kann Yves in die Wirklichkeit zurückfinden, wie ihm den Verlust seiner Eltern und Geschwister beibringen, wie ihm Schutz, Halt und Wärme geben?
So umkreist der Film von Stefan Haupt die beiden Hauptfiguren, den auf sich selbst zurückgeworfenen und von Gewissenbissen («Warum habe ich als einziger überlebt?») heimgesuchten Yves (Noé Ricklin) und die mütterlich fürsorgliche «Seelenhelferin» Eliane. Wie beim Schälen einer Zwiebel (dieses Bild wird auch von Kameramann Tobias Dengler verwendet) dringt die Betreuerin zur Seele des Kindes vor. Auch wenn diese spezielle Liebesgeschichte den intensiven, sensiblen Film trägt, werden zudem weitere familiäre Konflikte, verborgene Wunden und Kränkungen aufgedeckt. Eliane hat zwei Töchter mit verschiedenen Vätern, die nachdenkliche Helen (Elisa Plüss) und die aufmüpfige punkige Alice (Chiara Carla Bär). Helens Vater ist gestorben, und von Adrian (Martin Hug), Alices Vater, hat sich Eliane getrennt.
Stefan Haupts berührendes Familiendrama spürt der Frage nach Schuld und Unschuld, Zusammengehörigkeit, Familienbanden, Schmerz und Heilung nach. Vor allem ist «Finsteres Glück» ein Plädoyer für Liebe und Familiensolidarität. Am Ende hält wie bei der Pietà eine Mutter ein Kind im Arm. Die Welt ist versöhnt. Zu dem starken Eindruck, den dieser Film nachhaltig hinterlässt, tragen vor allem Eleni Haupt, die Frau des Regisseurs, und grossartig!, der zehnjährige Zürcher Noé Ricklin als Waisenknabe Yves bei.
Wir trafen den Schriftsteller Lukas Hartmann in Zürich zum Gespräch anlässlich einer Bernhard-Matinée. Er ist auf Lesetour und stellt sein jüngstes Werk «Ein passender Mieter» vor.
Bei der Verfilmung zweier Bücher, «Pestalozzis Berg» und «Anna annA», waren Sie am Drehbuch beteiligt. Bei der neusten Romanverfilmung «Finsteres Glück» ist das nicht der Fall. Fiel es Ihnen schwer, Ihr Buch quasi aus der Hand zu geben?
Lukas Hartmann: Ich habe den Film begleitet, indem ich die verschiedenen Versionen des Drehbuchs aufmerksam gelesen habe und mein Feedback Regisseur Stefan Haupt geschickt habe. Ich wollte bewusst nicht selber mitschreiben, weil ich gelernt habe, dass es für den Film andere Formen von Vorstellung braucht. Ich finde auch, dass das Drehbuch, das ich abgesegnet habe, wie auch der Film gut herausgekommen sind. Es ist geglückt, glaube ich.
Sie sind ein guter Beobachter und akribischer Beschreiber, beispielsweise des Isenheimer Altars. Welche Bedeutung hat dieser Altar in Colmar für die ganze Geschichte?
Um den Isenheimer Altar habe ich die Geschichte gebaut. Er steht in der Mitte des Romans, ist ein Angelpunkt, um den sich vieles dreht. Man geht davon aus, dass Matthias Grünewald wie auch Yves eine Sonnenfinsternis erlebt hat. Das hat mich immer schon fasziniert. Bereits als 13-/14-Jähriger habe ich dieses Werk aufmerksam betrachtet. Es ist eines jener Bilder, die mich am tiefsten berühren. Es geht in meinem Film ja auch um Fragen von Schuld und Erlösung und Auffahrt. Die Altarbilder sollten seinerzeit auch Kranken helfen, wenn sie dort gebetet haben.
Die Hauptfigur Eliane sagt einmal, sie sei nicht gläubig. Und doch hat Ihr Roman viel mit Glauben zu tun.
Dass Menschen glauben, der Glaube könne heilen, hat mich sehr bewegt. Was bedeutet das für ein Kind, das glauben möchte, seine Eltern seien nicht tot, sondern zurückkämen, und einsehen muss, dass dies nicht so ist? Eliane glaubt wohl, dass man Kindern in dieser Situation helfen kann mit der Hoffnung, dass er neu Beziehungen aufbauen kann – in eine Seele, die sich abzusperren begonnen hat.
Buch wie Film handeln von Verlust und Heilung, Hoffnung und Vertrauen.
Ja, da stellt sich die Frage nach Heilung. Heute haben wir ein sehr mechanistisches Verständnis von Heilung. Wenn die richtigen Tabletten verabreicht werden, wenn das Richtige herausgeschnitten wird, kann Heilung beginnen. Heilung war im Mittelalter umfassender, etwas Ganzheitliches.
Buch und Film können sich ergänzen, aber auch auseinanderdriften. Welchen Eindruck haben Sie?
Ich finde, dass der Film sehr nahe an meinem Roman bleibt. Mit diesem Film kann ich sehr gut leben, auch mit der Figur von Yves. Es ist unfassbar, wie ein neunjähriger Bub die Stimmungen erfasst und wiedergeben kann.
Sie haben die Figuren geschaffen und eine bestimmte Vorstellung von ihnen. Haben Sie sich mit den Filmfiguren anfreunden können?
Nach einigen Momenten. Eliane habe ich mir anders vorgestellt, aber sie hat mich dann überzeugt. Erstaunlich ist aber auch, dass ich mir den Yves ziemlich genauso vorgestellt habe. Er entspricht meinem inneren Bild auf verblüffende Weise – Mimik, Ausdruck, Augen, es passt sehr viel zusammen.
Der Titel «Finsteres Glück» ist ambivalent, er weist auf die Sonnenfinsternis hin und das Glück, das abhandengekommen ist, das man aber wiedergewinnen kann – etwa durch Liebe. Ist es das, was Sie mit dem Titel assoziieren wollten?
Ja, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. So war es von mir gedacht.
Es geht im Grunde um zwei Familien und Krisen – um die des Waisenknaben und die der Eliane. In dieser Entwicklung, in den Krisen steckt auch eine Chance.
Es war mir wichtig, dass der Roman am Ende offen bleibt. Es kann ja sein, dass Yves sein Trauma überwindet. Die Familie könnte zum Erlöser werden, denn auch die beiden Töchter Elianes engagieren sich überraschend für Yves.
Das bedeutet: Yves ist Kristallisationspunkt, er kittet die Risse in Elianes Familie.
Das könnte man sagen. Er bringt die Familie auf neue Weise zusammen. Ob er sie kitten kann, ist eine andere Frage.
Auch Ihr jüngster Roman «Ein passender Mieter» befasst sich mit einer Familie. Er schildert aus zwei Perspektiven die Konfrontation mit einem Mieter, von Margret und ihrem Sohn Sebastian, der ausgezogen ist und Theologie studiert. Die Krise ist freilich anders gelagert, Vater, Mutter und Sohn haben es mit einem Mieter und Messerstecher zu tun. Beschreiben Sie damit einen Mikrokosmos unserer Gesellschaft?
Man könnte es schon so sehen. Etwas Undenkbares bricht in eine Familie ein und löst vieles aus. Das hat auch mit unserm gesellschaftlichen Zustand, mit der Angst zu tun, dass sich in harmlosen Wohngegenden sogenannte Schläfer einnisten, de Terroraktionen vorbereiten. Das hat eine Aktualität, über die wir nachdenken müssen. Wie gross soll unser Misstrauen eigentlich sein? Was heisst in solchem Fall Toleranz? Herrscht dann nur noch Gleichgültigkeit? Ich finde, das sind Schlüsselfragen der heutigen Gesellschaft, und ich möchte sie mit diesem Roman stellen.
Misstrauen schürft Angst. Kern des Romans ist die Tatsache, dass das Unheil, das Böse mitten unter uns sein kann.
Sogar in uns. Niemand schaut in sich selbst hinein. Was ist da zu finden? Margret wird damit konfrontiert, mit ihrer eigenen Gewaltbereitschaft.
Noch eine Frage zum Film «Finsteres Glück». Am Ende ruht Yves in den Armen Elianes. Das erinnert mich an die berühmte Pietà. Ist das in Ihrem Sinn?
Ja (zögerlich). Das Bild zeigt bei der Tunnelfahrt eine innere Ruhe, Geborgenheit. Der Junge kann sich wieder sicherer fühlen.
Eine allerletzte Frage: Können Sie sich an ein Interview erinnern, in dem Sie nicht auf Ihre Frau, die Bundesrätin Simonetta Sommaruga, angesprochen werden?
Schon lange nicht mehr. Ich weiche den Fragen nicht aus, aber sie müssen nicht sein.
Lukas Hartmann
Eigentlich Hans-Rudolf Lehmann
* 29. August 1944 in Bern,
verheiratet mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga,
sein Bruder ist Jürg Lehmann, Journalist, früher Chefredaktor «Blick»
Veröffentlichungen:
1978 Pestalozzis Berg
2010 Finsteres Glück
2012 Räuberleben
2013 Abschied von Sansibar
2015 Auf beiden Seiten
2016 Ein passender Mieter
Diogenes Verlag, Zürich
«Paula Modersohn-Becker: «Drei gute Bilder und ein Kind»
Von Rolf Breiner
Um die Jahrhundertwende, um 1900, wurden Frauen nicht nur politisch (Suffragetten in England), sondern auch künstlerisch aktiv. Hier geht es um die sogenannten «Malweiber », junge, unerschrockene Frauen, die sich gegen die männliche Dominanz auflehnten und ihren eigenen Ambitionen folgten. Eine von ihnen war Paula Modersohn-Becker (1876-1907). Sie steht im Zentrum des Spielfilms des deutschen Regisseurs Christian Schwochow, verkörpert von der Tessinerin Carla Juri.
Worpswede – ein Landstrich im Bremer Raum – wurde eine Marke, eine Künstlerkolonie, 1889 gegründet, in der auch Frauen als Malerin ausgebildet wurden. Die Moorlandschaft zur Nordsee hin, das landschaftliche und bäurische Ambiente inspirierte die jungen Leute. Eine der Frauen aus bürgerlicher Bremer Gesellschaft war Paula Becker. Mit 24 Jahren hatte sie sich entschlossen, sich ganz der Malerei zu widmen und stiess um 1900 zur Künstlerkolonie Worpswede. Hier lernte sie den Maler Otto Modersohn kennen, den sie dann heiratete. Das ging – so erzählt der Film «Paula» – fünf Jahre mehr oder weniger gut, bis der jungen Frau der Kragen platzte, sie Mann und dessen Tochter Elsbeth aus erster Ehe verliess und Paris aufsuchte. Ihr war der häusliche und künstlerische Rahmen zu eng geworden. Ihre Freundin Clara Westhoff und der Dichter Rainer Maria Rilke, der die Künstlerkolonie aufgesucht hatte und sie später despektierlich als Ort «deutscher Kleingartenkunst» bezeichnete, hatte ihr ein Bahnbillett für die Seinestadt geschickt. Hier lebte sie befreit vom Kolonie- und Ehejoch auf, fand einen Liebhaber und schöpferische Kraft. Ihr bevorzugtes Sujet waren Köpfe, Menschen aus der ländlichen Umgebung, Mütter und Selbstporträts. Bilder, die im Gegensatz zur Worpsweder Doktrin nicht Natur abbildeten, sondern eine ganz neue Formsprache entwickelten. Ihr Ehemann hatte ihr vorgeworfen, sie male «Hände wie Löffel, Nasen wie Kolben, Münder wie Wunden, Ausdruck wie Cretins» und forcierte so den Bruch mit Paula.
Nun darf man von diesem Spielfilm nicht erwarten, dass er ein Biopic bietet. Er konzentriert sich auf die Entwicklung der Malerin, nimmt sich Freiheiten und ist nicht immer historisch treu. Der künstlerische Werdegang wird verkürzt und verdichtet skizziert. Am Anfang steht eine leere Staffelei, am Ende ein meisterliches Selbstbildnis. Regisseur Christian Schwochow und seine Autoren Stefan Kolditz und Stephan Suschke verfolgen neben der künstlerischen Emanzipation Paulas auch ihr Verhältnis zur Ehe, Liebe, Malerei und Selbstverwirklichung. Ihr Lebensmotto: «Ich gehe gern, wenn ich drei gute Bilder gemacht und ein Kind gekriegt habe.» Sie starb im November 1907 im Alter von nur 31 Jahren, drei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Mathilde. Paula Modersohn-Becker, die zeitweise das M aus ihren Malerinitialen getilgt hatte, hinterliess rund 750 Gemälde und 1000 Zeichnungen.
Christian Schwochow liegt mit seinem Film im Trend der Künstlerporträts wie «Cezanne et moi» oder «Egon Schiele». Er beschreibt punktuell die Geschichte einer Emanzipation und gleichzeitig eine Liebesgeschichte. Otto Modersohn, zurückhaltend und glaubwürdig gespielt von Albrecht Abraham Schuch, gesteht spät seine Fehleinschätzung, steht aber letztlich zu ihr, der unbequemen, rebellischen, unangepassten Malerin. Carlo Juri («Feuchtgebiete»), mit den Bildern und Werken Giovanni Segantinis und Alberto Giacomettis aufgewachsen, bietet als Paula eine reife schauspielerische Leistung. Deren Leidenschaft, aber auch Verzweiflung, Abstürze, gleichwohl Glauben an ihre Kunst, ihre Bilder, die nicht Formen, sondern Seelen abbilden sollten, werden auf der Leinwand spürbar, nachvollziehbar, einleuchtend. Rodin und Cezanne bleiben Randfiguren, nicht aber der Dichter Rainer Maria Rilke, der Paula zum Ausbruch, zur Reise in den Künstlerschmelztiegel Paris um1905 ermutigt. Ihn gibt der Schweizer Joel Basman, etwas allzu glatt und diabolisch, spöttisch und flüchtig.
Wir trafen Christian Schwochow anlässlich der Filmuraufführung am Filmfestival Locarno 2016.
Wie haben Sie die Aufführung auf der Piazza Grande empfunden?
Christian Schwochow: Gigantisch. Ich war sehr nervös und aufgeregt, hatte grosses Lampenfieber und bin ja mit dem gerade fertig gewordenen Film nach Locarno angereist. Es wurde ein irrer Abend, den ich nicht vergessen werde. Das Licht, die Menschen. Es war die tollste Vorstellung, die ich je erlebt habe.
Wie sind Sie auf das Thema Paula Modersohn-Becker gestossen?
Über mehrere Jahre haben die Autoren Stefan Kolditz und Stephane Suschle den Stoff entwickelt. Irgendwann sucht man den Regisseur. Das ist über vier Jahre her. Ich bin angefragt worden, dann nahm das Projekt seinen Lauf. Bei Paula gibt es keinen Anlass, kein Jubiläum, kein Todes- oder Geburtstag. Wenn man die Geschichte dieser beiden Menschen Paula und Otto ansieht, findet man einige heutige Themen: Wie lebe ich mein Leben mit Familie und Kunst? Wie radikal kann ich sein, wie angepasst lebe und arbeite ich? Wie sehr muss ich mich verkaufen? Da steckt vieles drin, was auch die Menschen heute umtreibt, auch wenn die Frauen freier geworden sind.
Es gibt verschiedene Ebenen: Paula, die aus der Ehe ausbricht, Otto, der frustriert zurückbleibt und sich auch befreit. Hier die Frau, die ihren Weg geht, dort das Mann-Frau-Verhältnis Anfang des 20. Jahrhunderts. Dazu diese Künstlerenklave Worpswede, wo Paula arbeite, lebte und sich auflehnte.
Ja. Es gab auch ein paar andere Frauen wie Clara Westhoff, die aber nicht durch die Wand gingen wie Paula.
Einerseits beschreiben Sie in Ihrem Film die Befreiung einer Frau, andererseits eine Liebes- und Ehegeschichte.
Ein klassisches Biopic zu schaffen, wo man Stationen abarbeitet, hat mich nicht interessiert. Es ging mir wirklich um diese Themen, wie von Ihnen beschrieben.
In der Geschichte von Paula und Otto und anderen spiegelt sich die Zeit.
Das ist mir sehr wichtig gewesen.
Gleichwohl haben Sie es vermieden, zu viel aus Briefen, Aufzeichnungen zu zitieren, wobei ein Satz hängenbleibt: «Ich will drei gute Bilder machen und ein Kind kriegen.»
Ja, aber es gibt noch andere Zitate von Paula wie «Das Leben soll ein Fest sein».
Wie haben Sie denn Zugang zu Paulas Bildern gefunden?
Als ich Teenager war, wollte ich mal Malerei studieren. Mich interessierte schon früh die Transformation in der Kunst, wie die Moderne begann und der Impressionismus in den Futurismus und Expressionismus überging. Darin kannte ich mich schon ziemlich aus. Die Bilder Paulas sind nicht dekorativ, wohl auch nicht jedermanns Sache.
Wie geht man als Filmer an Bilder ran, über die man also auch Bilder macht?
Wir haben nicht versucht, die Quadragen der Gemälde zu übersetzen. Wir haben versucht zu erzählen, wie Paula die Welt wahrgenommen hat. Welche Reize hat Paula in einer gewissen Situation aufgenommen? Farblich haben wir uns an Paulas Farbpalette angelehnt und die Landschaft um Worpswede einbezogen.
Die letzten Bilder bleiben haften. Paula liegt tot auf dem Teppich. Dann tritt sie nochmals hinter einem ihrer Bilder hervorhervor. Sie lebt also weiter…
Sicher. Der Tod als letzter Atemzug, aber die Kunst geht weiter, bleibt. Die Bilder tragen wir in uns. Darum dieser Abschluss.
Tipp: «Die Malweiber. Unerschrockene Künstlerinnen um 1900».
Katja Behling und Anke Manigold beschreiben diese Entwicklung, sind eingetaucht in die damalige Zeit. Sie schildern diverse Künstlerkolonien wie Worpswede und Fischerhude, Hiddensee und Nidden, aber auch Berlin und Zürich (Sophie Taeuber-Arp, Clara von Rappard), mit Kurzporträts über Paula Modersohn-Becker, Clara Rilke-Westhoff und vielen anderen. Ein Streifzug durch ein Kapitel Kunstgeschichte und Emanzipation. Es gibt den gebundenen Originalband, 2009 Elisabeth Sandmann Verlag, München, und eine gekürzte Taschenbuchausgabe, 3. Auflage 2016, Insel Verlag Berlin.
Filmtipps
Paula
rbr. Eine Malerin emanzipiert sich. Sie war eine Pionierin in der modernen Kunstgeschichte: Paula Modersohn-Becker (1876-1907). In der Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen entschied sie sich 24 Jahre alt für die Malerei – gegen männliche Dominanz und Herrschaft. Sie heiratete den Maler Otto Modersohn und war dann fünf Jahre auf ein Hausfrauendasein beschränkt. Selbst ihr Ehemann schätzte ihr Maltalent gering ein und sperrte sich gegen ihren Mutterwunsch. 1907 sprengte sie den Eherahmen und reiste in das brodelnde Künstlermekka Paris, ermutigt von ihrer Freundin Carlo und dem Dichter Rainer Maria Rilke. Erst an der Seine konnte sie sich frei malen und austoben. Hier lebte sie, befreit vom Kolonie- und Ehejoch, auf, fand einen Liebhaber und schöpferische Kraft. Ihr bevorzugtes Sujet waren Köpfe, Menschen aus der ländlichen Umgebung. Ihre Bilder entwickelten im Gegensatz zur Worpsweder Natur-Doktrin eine eigene Formsprache. Der deutsche Regisseur Christian Schwochow schuf kein Biopic, sondern konzentriert sich auf die Entwicklung der Malerin. Der künstlerische Werdegang wird verkürzt und verdichtet. Schwochow verfolgt neben der künstlerischen Emanzipation Paulas auch ihr Verhältnis zur Ehe, Liebe, Malerei und Selbstverwirklichung. Der Film beschreibt punktuell die Geschichte einer Emanzipation und gleichzeitig eine Liebesgeschichte. Otto Modersohn, zurückhaltend gespielt von Albrecht Abraham Schuch, gesteht, die Kunst seiner Frau verkannt zu haben, steht aber zu ihr, der unbequemen, rebellischen, Malerin. Carlo Juri («Feuchtgebiete») bietet als Paula eine reife schauspielerische Leistung. Der Dichter Rainer Maria Rilke, der Paula zum Ausbruch ermutigt, wird vom Schweizer Joel Basman verkörpert, etwas glatt und diabolisch, aber auch spöttisch. Ein spannendes Beziehungs- und Künstlerdrama, das sich nicht als historisches Biopic versteht, sondern als moderner Beitrag über Emanzipation.
****°°
Rogue One: A Star Wars Story
rbr. Raum für weitere Raumaction. Die Space-Saga «Star Wars» ist Kult und längst zur milliardenschweren Marke geworden. Das Kino- und Merchandising-Erfolgsprodukt der Marke Lucas soll mit einer weiteren Trilogie fortgesetzt werden. Hollywood, in diesem Fall die Disney Company, ist hungrig und will die Lücke zum neuen Trilogie-Start mit einem so genannten Spin-off-Film verkürzen, also einer Nebengeschichte. Anknüpfungspunkt ist bei «Rogue One» (so der Name eines Rebellen-Kommandos) die Frage: Wie können die Rebellen den Todesstern vernichten, wie an die Pläne dieses Vernichtungsplaneten kommen? Und so tauchen wir ein in die grösste Schlacht aller Star-Kriege. Die Wissenschaftlertochter Jyn Erso (Felicity Jones) – ihr Vater (Mads Mikkelsen) hat den Todesstern mit einer geheimen Selbstzerstörungsfunktion entworfen – handelt. Sie versucht gegen den Beschluss der Rebellenkoalition, die Plänen auf dem Planeten Scarif zu rauben – mit Hilfe eines unerschrockenen Kämpfertrupps, mit dem wagemutigen Rebellenoffizier Cassian (Diego Luna), Bodhi Rock (Riz Ahmed), einem abtrünnigen Pilot der imperialen Truppen, dem witzigen Droiden K-25O (Alan Tudyk) und anderen Rebellen. Das geht nicht ohne bombastische Explosionen (der Wüstenplanet Jedha wird vom Todesstern quasi ausgelöscht), Luft- und Bodengefechten, rasanten Flugkapriolen und nicht zuletzt böse Machenschaften der Imperialen ab, dirigiert vom bedrohlichen Darth Vader. Neben bekannten Ingredienzien wie dem böse schnarrenden Darth Vader samt Laserschwert, Prinzessin Leia (Kurzauftritt) und den roboterhaften Stormtroopers hat der britische Regisseur Gareth Edwards das martialische Spacemärchen um einige Figuren bereichert um den blinden Martial-Arts-Krieger Chirrut Imwe (Donnie Yen), den rauen Krieger Baze Malbus (Jian Wen) und den Freiheitskämpfer Saw Gerrera (Forest Whitaker), Retter der jungen Jyn, aber auch um die schwarzen Death Troopers. Das düstere Prequel-Produkt «Rogue One» (etwa mit Schelm/Schurke Eins zu übersetzen) ist zeitlich zwischen den Episoden III und IV anzusiedeln. Zwar steht eine Frau im Zentrum und führt den rebellischen Stosstrupp an, doch im Grunde erweist sich dieser «Star Wars»-Ableger als Kriegsfilm mit ungeheurem Vernichtungspotenzial. Die Magie, das Märchenhafte der alten Episoden ist dahin, dafür wird ein Special-Spektakel geboten, das die Schauplätze, sprich Planeten, wechselt wie Helen Fischer ihre Kostüme.
***°°°
Arrival
rbr. Fremdenfreundlich, fremdenfeindlich. Kann ja vorkommen, dass etwas Fremdes, wirklich fremdes Ausserirdisches ankommt – im Kino. Zuerst herrscht Neugierde, die dann das Geschehen meistens von Misstrauen und Argwohn überlagert. Phantasie? Flüchtlingen sind eben auch Fremde, die etwas von uns wollen, die uns herausfordern. Von nichts anderem handelt das SF-Drama «Arrival» vom Frankokanadier Dennis Villeneuve. Zwölf fremde Flugkörper, einem Zeppelin oder Flacon nicht unähnlich, landen auf verschiedenen Punkten der Erde, in Montana, in Russland, China, Sudan, Dänemark und anderswo. Die amerikanischen Behörden bieten die Linguistin Dr. Louis Banks (Amy Adams) und den Physiker Ian Donnelly (Jeremy Renner) auf, um mit den fremden Wesen zu kommunizieren. Auch wie macht man sich krakenartige Riesengeschöpfen (oder Phantomen) verständlich? Dr. Banks freunden sich quasi mit Alienwesen an, schafft den Durchbruch. Doch die menschliche Geduld ist sehr begrenzt, und so kann auch der sanfte Militarist Col. Weber (Forest Whitaker) nicht verhindern, dass mit scharfen Geschützen aufgefahren wird. Dabei erweisen sich die Aliens gar nicht als aggressiv – im Gegenteil. Villeneuve Begegnung der irdisch-ausserirdischen Art ist tiefsinnig und existenziell, verklärt, aber schlüssig, moralisch und entlarvend. Ein intelligenten Gedankenspiel mit sehr menschlichem Hintergrund, wesentlich getragen von der Schauspielerin Amy Adams («Big Eyes», «Batman vs. Superman», «Noctural Animals»). Kein Space-Spektakel, sondern ein ausserordentlicher, mediativer Exkurs über Verlust und Trauer, aber auch über Kommunikation und Verständigung und die Frage: Wie hängen Sprache und Gedanken zusammen, wie sind sie verbunden, wie drücken sie sich aus? Regisseur Villeneuve inszeniert übrigens eine Neuauflage des SF-Klassikers «Blade Runner 2049» (Start: Herbst 2017). Das wird spannend.
*****°
I, Daniel Blake
rbr. Arbeitslosenelend. In Cannes und am Filmfestival Locarno wurde Ken Loachs Arbeitslosendrama gefeiert: Goldene Palme und Publikumspreis. Schauplatz ist Newcastle, Nordostengland. Daniel Blake (Dave Johns), 59, ist gelernter Tischler. Nun steht er da – arbeitslos, aber (noch) nicht hoffnungslos. Ein sympathischer Arbeiter, raue Schale mit Herz, wie er im Buche steht. Was ist der Mensch wert, wenn er von Marktanalysten, Strukturbereinigern und Produktionskalkulatoren als wertlos eingestuft wird? Wieviel Würde bleibt einem, wenn man in der Arbeitswelt herabgewürdigt, wenn nicht gar herabgewürgt wird? Tischler Blake will arbeiten, darf aber nicht nach einem Herzinfarkt, vom Hausarzt bescheinigt. Doch die sturen Behörden sehen das anders, und so gerät Daniel Blake in die Mühle der Administration. Man nötigt ihn, auf Jobsuche zu gehen, freilich nicht als ausgewiesener Schreiner. Und so muss der «Klient» (so der geläufige Behördensprachduktus) sich an Formularen online abarbeiten, und an unsinnigen Kursen teilnehmen. Regeln, Formulare, hartherzige «Handlanger» dieses Sozialsystems bringen keine Hilfe, sondern säen nur pure Verzweiflung. Der ausgemusterte Kämpe Blake kümmert sich gleichwohl um eine Seele, der es ebenso dreckig geht: Katie (Haylesy Squires), alleinerziehende Mutter, wurde von London nach Newcastle zwangsumgesiedelt, weiss nicht, wie sie mit ihren beiden Kindern über die Runden kommen soll, prostituiert sich in der Not. Blake rebelliert für sich und für sie, geht auf die Strasse. Das System schlägt zurück, verhängt Sanktionen – Ken Loach, der alte Filmkämpe mit dem grossen Herzen für arme oder arm gemachte Kreaturen, zeigt in aller Schonungslosigkeit die Erbarmungslosigkeit eines System/Staats mit angeblichem sozialem Mantel, punktuell mit trockenem Humor der britischen Art gemildert. Trotz leichter Übertreibungen und parteiischem Engagement packt Ken Loachs politische Anklage und pathetisches Plädoyer. Keiner nutzt das Kino als moralische Anstalt und Forum so gekonnt und anschaulich wie der Brite Ken Loach.
****°°
Le confessioni
rbr. Das Schweigen in Heiligendamm. Im Ostseebad Heiligendamm fand tatsächlich 2007 das 33.Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (G-8) statt. Nicht von ungefähr hat Roberto Andò also seinen kammerspielartigen Thriller just an diesem Ort angesiedelt. Die wichtigsten Finanzminister haben sich dort versammelt, um ein neues globales Finanzwesen zu beraten. Auf Bitte Daniel Rochés (Daniel Auteuil), Chef des Internationales Währungsfonds, wurden auch der Kartäusermönch Roberto (Toni Servillo) sowie eine Kinderbuchautorin und ein Sänger eingeladen, die sich beide für soziale Projekte engagieren. Roberto kommt eine besondere Rolle zu, er soll Roché vor den geheimen Gesprächen die Beichte abnehmen. Doch dann passiert’s: Der Banker Roché wird tot aufgefunden. Die Ermittlungen mit dem Sicherheitschef des Hotels (Moritz Bleibtreu) an der Spitze setzen ein, und der Pater gerät in den Fokus. Was hat Roché verraten, was weiss der Beichtvater? Bis auf ein paar schöne Aussichten in Heiligendamm beschränken sich Regisseur Roberto Andò und sein Kameramann Maurizio Calvesi auf Innenräume. Fast schon klaustrophobisch entwickelt Andò seinen Psychothriller. Pater Roberto wird verdächtigt und unter Druck gesetzt, doch er schweigt. Dieses hochspannende, aussergewöhnliche Krimikammerspiel wird vor allem von Toni Servillo getragen. Sein Gesicht, seine Mimik sprechen Bände – oder auch nicht. Es geht also auch ohne Action, Gewaltbombastik und Highspeed!
****°°
Sully
rbr. Ein Held wider Willen. Der Vorfall ist bekannt und machte nicht nur in den USA Schlagzeilen. Am 15. Januar 2009 setzte Flugkapitän Chesley «Sully» Sullenberger einen Airbus A mit 155 Passagieren an Bord auf den Hudson River mitten in New York. Und alle kamen mit dem Schrecken und ein paar Kratzern davon! Ein Wunder, ein Medienereignis. Doch dann wurde die Luftfahrtsbehörde aktiv und setzte eine Untersuchungskommission ein. Sully und sein Copilot Jeff Skiles wurden aufs Peinlichste angehört (schier verhört). Man wollte herausfinden, ob sie nicht auf einem naheliegenden Flughafen ausweichen konnten und zu viel Risiko in Kauf genommen hätten. Diese Untersuchungen und die Befindlichkeiten der Piloten, die zu Helden hochgejubelt und dann unsensibel wie vor einem Tribunal hinterfragt wurden, stehen im Zentrum des Dramas «Sully» von Clint Eastwood. Mit Geschick und Einfühlungsvermögen breitet Eastwood das Anhörungsszenarium aus, spickt es dezent mit Szenen aus dem Cockpit und Momenten der Landung und Rettung. Das ist bestes Kinohandwerk eines alten Haudegens. Und mit Tom Hanks als Sully, dem Held wider Willen, hat er einen idealen Darsteller gefunden, kongenial ergänzt durch Aaron Eckhart als Partner im Cockpit und danach. Heldenepen – ohne Kampf, Krampf und Gewalt – voller Emotionen und Hintersinn schafft Hollywood noch immer mit Bravour. Eastwood inszenierte ein psychologisches Porträt, entwickelt einen perfiden Prozess und huldigt auf seine dezente Art einem realen Helden. Unnachahmlich.
****°°
Fantastic Beasts and Where to Find them
rbr. Der Magier mit den Monstern. Der Zauberlehrling und -meister Harry Potter, seine Schul- und Zauberwelt ist weltweit bekannt geworden – in Büchern und Bildern. Die britische Autorin Joanne K. Rowling hat zudem eine Art Lehrbuch zur Fantasy-Reihe verfasst, das bereits 2001 erschienen ist. Der Verfasser des fiktiven Buchs ist ein gewisser Newt Scamander, und der wird just zum Leben erweckt in der Verfilmung «Fantastic Beasts and Where to Find Them – Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind». Der Jungspund Scamander (Eddie Redmayne – bekannt geworden als Stephen Hawking in «Die Entdeckung der Unendlichkeit – The Theory of Everything») macht 1926 ungewollt New York unsicher. Ihm, dem eigenwilligen Magier, sind zauberhafte Monster aus seinem Zauberkoffer entflohen. Die suchen also die Megacity heim, und besagter Kofferträger versucht nun, diese ihm ans Herz gewachsenen Tierwesen einzufangen. Das kostet Nerven, Einsatz und magische Geschicklichkeit. Die smarte Magiebeamtin Tina Goldstein (Katherine Waterston) samt Sexbomben-Schwester Queenie (Alison Sudol) und der etwas unbeholfene, aber nette und verlässliche Arbeiter Jacob Kowalski (Dan Fogler) verstärken die Bemühungen des exzellenten, aber auch exzentrischen Zaubersonderlings. Der hatte just von einer Forschungsweltreise in New York Station gemacht und muss nun zwischen den Welten agieren. Das Chaos in Manhattan – die Erde birst, Wolkenkratzer werden zusammengestaucht, Autos demoliert – ruft auch die Präsidentin des Magischen Kongresses der USA (Carmen Ejogo) und den zwielichtigen Agenten Percival Graves (Colin Farrell) auf den Plan. Newt und Gehilfen werden verhaftet, aber da gibt noch die kleinen fixen Freunde, die… Aber das muss man selber erlebt haben, wenn der ganze Zauber um Muggels (in Amerika: No Maj), skurrile Kreaturen, Sektierer, Magier und Anti-Magier so richtig losgeht. In dem phantastischen amüsanten Spektakel tauchen nicht nur ein paar weitere bekannte Filmstars bei genauem Hinsehen auf wie Jon Voight als Verlegerpapst und Johnny Depp, biestrig maskiert, als böser Widersacher, sondern werden auch ein paar politische Seitenhiebe verteilt. Der abenteuerliche Hokuspokus (Regie: David Yates, der bereits die letzten Harry-Potter-Filme inszeniert hatte) aus der Rowling-Küche geht weiter. Die Autorin Rowling hat vier weitere Teile geplant. Das kann ja heiter werden mit dem Niffler, der elsterverwandten Kreatur, die alles stibitzt, was irgendwie glitzert, dem riesenhafter Nilpferdableger Erumpent und all den gutmütigen und hinterhältigen Magiern. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!
****°°
A Good Wife
rbr. Sich der Wahrheit und Wirklichkeit stellen. In einem Vorort Belgrads lebt die fünfzigjährige Milena (Mirjana Karanović). Sie führt ein geordnetes bürgerliches Leben, funktioniert als pflichtbewusste Haus- und Ehefrau und ist offensichtlich zufrieden mit dem behaglichen Alltag. Doch der Augenschein trübt. Eine frühe Einstellung lässt Böses ahnen: Milena betrachtet ihre Brüste betrachtet, tastet sie ab. Später bestätigen sich vage Verdachtsmomente: Sie hat Brustkrebs, versucht jedoch, die Tatsache zu verdrängen und lenkt sich ab. Beim rigorosen Hausputz stösst sie auf einen Kasten mit Erinnerungsstücken ihres Mannes Vlada (Boris Isaković), unter anderem auch auf eine Videokassette. Und die dokumentiert die Erschiessung bosnischer Zivilisten während des Bürgerkriegs. Vlada hatte das serbische Sonderkommando. Diese Konfrontation mit der Vergangenheit ihres Mannes verstört Milena. Sie begreift, dass Freunde und Nachbarn mehr wissen, in diesen Kriegsfall verwickelt sind. Milena ist vor schwere Entscheidungen gestellt – sowohl was ihre Gesundheit, aber auch ihre Familie und ihr Gewissen angeht. Die Geschichte vom «Good Wife» greift eine wahre Geschichte auf, den Fall «Skorpion», berichtet die Autorin und Regisseurin Mirjana Karanović. Eine paramilitärische Spezialeinheit hatte sechs gefangene Bosnier exekutiert und gefilmt. Dieses Kriegsverbrechen steht jedoch nicht im Mittelpunkt des Familien- und Gesellschaftsdramas. Einerseits geht es um Verdrängung und Verleugnung der Vergangenheit, aber auch um Selbstfindung und den Mut einer Frau, mit Behaglichkeit und geschönter Routine zu brechen und sich nicht aus falscher Rücksichtnahme und Bequemlichkeit auf eine Lebenslüge einzulassen. Das Drama wird von der Schauspielerin Mirjana Karanović geprägt und getragen. Eine ausserordentliche packende Leistung vor und hinter der Kamera, die es verdient hat, mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet zu werden.
*****°
Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
rbr. Ein Roboter mit Herz. Der deutsche Kinderbuchklassiker «Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt» von Boy Lornsen, Bildhauer und Schriftsteller (er starb 1995), hat zwar bereits einige Jahre, nämlich 50, auf dem Buckel, doch an Abenteuerlust und Phantasie nichts verloren. Zwar hatte die ARD das Buch bereits 1972 verfilmt und dabei auf Marionetten in realer Umgebung gesetzt, doch so richtig zum Kinoleben erweckt wurden die Abenteuer um den erfinderischen Knaben Tobbi und seinen Roboterfreund Robbi erst jetzt. Folgerichtig hat Drehbuchautor Jan Berger («Der Medicus») einige zeitgemässe Anpassungen gegenüber der Romanvorlage und Erweiterungen vorgenommen. Bergers jüngste Bearbeitung des Karl-May-Stoffes «Winnetou» wird übrigens ab 25. Dezember in drei Teilen aus gestrahlt (RTL) – mit Wotan Wölke Möhring, Nik Xhelilaj und Jürgen Vogel. Nun denn, Tobbi (Arssen Bultmann) ist schüchtern, ängstlich, als Aussenseiter abgestempelt, und lässt sich vom fiesen feisten Schulkameraden Justin unter Druck setzen. Aber Tobbi hat Justin und Konsorten eins voraus: Er hat Fantasie und ist erfinderisch. Davon kann sein Vater (Ralph Caspers), ein Kochfreak, ein Loblied singen. Seine Mutter betreibt (Jördis Triebel), handfest und bei Motorradrockern hoch angesehen, die Werkstatt «Findteisens Schrauberparadies». Tobbi lebt in der norddeutschen Provinzidylle Tütermoor und stösst eines Tages auf einen Metallklotz, der vom Himmel gestürzt ist. Und der entpuppt sich als Roboter Robbi, der aus einem Raumschiff gefallen ist und seine Eltern verloren hat. Besagter Ausserirdischer erweist sich nicht nur des Deutschen mächtig, sondern auch handwerklich geschickt. Tobbi und Robbi freunden sich nach kleinen Anlaufschwierigkeiten an. Und nun geht’s richtig los: Tobbi hat ein kurioses Gefährt entworfen (auf dem Papier), mit Hilfe des pfiffigen Roboters mit Herz und einer Rockergang entsteht das Fliewatüüt, ein Vehikel, das fliegt, zu Lande und zu Wasser läuft. Mit diesem variablen Mobil starten die Freunde Tobbi und Robbi zum Nordpol, um die notgelandeten ausserirdischen Eltern des Metallwesens zu retten. Vom empathischen Roboter hat auch der raffgierige Unternehmer Sir Joshua (Friedrich Mücke) Wind bekommen und beauftragt zwei Agenten (Alexandra Maria Lara und Sam Riley), den Roboter samt Herz aufzugreifen. Denn der Unternehmer von PlumPudding wittert das grosse Geschäft und will seinen Produkten besagtes Roboter-Herz einverleiben. – Was möglicherweise etwas kompliziert klingt, ist nichts anderes als eine phantasievolle Abenteuergeschichte um Einzelgänger und Aussenseiter, Verständnis und Freundschaft unabhängig von Äusserlichkeiten und Herkunft. Regisseur Wolfgang Groos («Die Vampirschwestern») hat die turbulente Reise kindgerecht inszeniert (ab 6 Jahre)– mit Herz, Humor und Verstand.
***°°°.
Sing
rbr. Tierisch gut. Man stelle sich vor: Castingshows wie «Deutschland sucht den Superstar» oder Schweizer Ableger kämen ohne mediengeile Menschen aus. In Garth Jennings‘ poppiger Animationsshow «Sing» zeigen Tiere beste Showqualitäten. Da kann man bestens auf menschlichen Glitzer, Glamour und Gags verzichten. Der Pandabär Buster Moon (Stimme im Original: Matthew McConaughey) ist ein Looser. Das von seinem Vater geerbte Moon-Theater steht vor dem Bankrott. Seine letzte Hoffnung setzt er auf eine Castingshow, bei dem (fälschlicherweise) 100 000 Dollar als Prämie versprochen werden. Der Ansturm sanges- und showfreudiger Kandidaten ist riesig: Da macht sich die Schweinemutter Rosita (Stimme: Alexandra Maria Lara deutsch/Reeser Witherspoon englisch), die 25 Ferkel plus Eber versorgt, frei, um am Wettbewerb teilzunehmen; da engagiert sich Johnny, «missratener» Sohn einer Gorilla-Gang, versucht eine schüchterne Jung-Elefantin ihr Glück, spielt sich der arrogante Mäuse-Jazzmusiker Mike in den Vordergrund und profiliert sich die Igelin Aash (Stimme: Stefanie Kloss/Scarlett Johansson). Unerschöpflich scheint das animalische Reservoir an musikalischen Talenten. Dumm ist nur, dass bei der aufwändigen Lichtshow mit Quallen und Seepferchen das Theater schlapp macht und zusammenkracht. Ist es noch zu retten? Zuschauer können sich so oder so auf eine rasante Revueperformance gefasst machen – mit über 80 Songs aus der Pop- und Rockgeschichte von «My Way» (gesungen von Seth MacFarlane), «Set It All Free» (Scarlett Johansson) oder Cohens «Hallelujah» (Tori Kelly) über «Faith» (Stevie Wonder), «Call Me Maybe» (Matthew McConaughey) bis zu «Venus», «Stay With Me», «Bamboléo», «Eye oft he Tiger» oder «Fly Me to the Moon». Ein Feuerwerk an musikalischen und tänzerischen Einfällen. Das animalische Musical plädiert für Solidarität, versprüht Feuer, Witz und viel Herz. Da sieht man gern über ein paar Überreizungen und billige Anbiederungen hinweg. Ein jeder kann sich seinen menschlichen Reim darauf machen
****°°
Peter Handke –Kann sein, dass ich mich verspäte
rbr. Schriftbilder mit und durch Handke. Er hat die deutschsprachige Literaturgeschichte in den letzten 50 Jahren geprägt wie kaum ein zweiter: Peter Handke, 1942 in Kärnten geboren und in Chaville sesshaft geworden. Er hat Werke wie «Die Angst der Tormanns beim Elfmeter» geschaffen, aber auch an Filmen wie «Der Himmel über Berlin» (mit Bruno Ganz) mitgewirkt. Über Jahre hat die Filmerin Corinna Belz, die auch den Maler Gerhard Richter porträtiert hat, den eigenbrötlerischen Schriftsteller in seinem Domizil bei Paris aufgesucht. Der Filmtitel «Peter Handke – Bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte» könnte auch eines seiner Werke meinen. Im aktuellen Filmfall handelt es sich indes um eine Notiz, die Handke der Filmerin Corinna Belz hinterlassen hat. Oft ist er im umliegenden Wald seines Landsitzes in Chaville bei Paris unterwegs, sammelt Pilze, hält inne. Tatsächlich sehen wir den bald 74jährigenSchriftsteller beim Pilzesortieren, bei alltäglichen Handgriffen, umgeben von Büchertürmen. Unzählige Arbeiten, Abhandlungen, Äusserungen markieren seinen Weg – von der «Publikumsbeschimpfung» (1966) über Theaterstücke («Kaspar», «Die Unvernünftigen sterben aus», 1974, Uraufführung im Theater am Neumarkt, Zürich) bis zu Gedichten, Romanen, Aufzeichnungen, Skizzen. Eingestreut werden Polaroidaufnahmen aus Handkes eigenem Fundus oder Filmszenen aus «Falsche Bewegung» (1975) oder «Der Himmel über Berlin» (Regie: Wim Wenders, 1987). Corinna Belz bleibt am Mann und seinen Worten, an Texten und Begebenheiten, ohne dass ihr Film sich als bebilderte Vorlesung entpuppt. Handke, der Unnahbare, kommt uns näher. Auch seine umstrittenen Positionen und Äusserungen zum jugoslawischen Bürgerkrieg werden journalistisch angesprochen. Handke hatte sich für die Serben eingesetzt und den Serbenführer Miloŝević, Kriegsverbrechen angeklagt, besucht. Es gibt diesbezüglich ein paar Erklärungen auch seitens Handkes Ehefrau Sophie Semin, aber keine Klärung. Corinna Belz vermag mit ihrem Film, die Aufmerksamkeit auf die Worte zu lenken. So entstand ein sehr literarischer Film, kein Biopic, sondern eine geistreiche Begegnung mit einem einsiedlerischen Literaten.
****°°
Wolf and Sheep
rbr. Hüten, verhüten, vertrieben. Der Tod reisst Lücken im Familienverbund wie der Wolf in der Herde. Ein Mann stirbt in einem abgelegenen afghanischen Bergdorf. Die Witwe sieht sich gezwungen, wieder zu heiraten und sei es einen Alten, der bereits zwei Frauen hat. Leidtragender ist der elfjährige Qodrat, Sohn der alleinstehenden Frau. Er wird so zum Aussenseiter wie auch das Mädchen Sediqa, die von den Jungen ausgegrenzt wird, weil ihre Grossmutter als Hexe gilt. Die beiden Aussenseiter freunden sich an und bilden eine kleine Partnerschaft. Unmöglich in einer Dorfgesellschaft, in der Jungen und Mädchen nicht miteinander verkehren sollen, in der die Burschen mit Steinschleudern üben und die Mädchen Ziegen und Schafe hüten sollen. Wenn dann jedoch ein Schaf verloren geht, sind die hütenden Mädchen schuld, weniger die unachtsamen Steinschleuderer, die eigentlich Schlimmes verhüten sollen. Und wenn einer von ihnen durch Fahrlässigkeit schuld am Augenverlust eines Knaben ist, hat er Strafe zu fürchten. Doch letztlich wird der «Verlust» dorfintern geregelt. Es gibt quasi Schadensersatz in Form eines oder mehrerer Tiere. Es ist ein karges Leben in einer unwirtlichen Landschaft, wo die Menschen abergläubisch sind und an Legenden glauben. Etwa an die vom Wolf, dem Kaschmir-Wolf, der sein Fell ablegt und sich in eine nackte grüne Frau verwandelt, die nächtens durchs Dorf wandelt. Die 26-jährige Regisseurin Shahrbanoo Sadat drehte mit «Wolf and Sheep» einen archaischen Film, wohl den ersten Spielfilm einer Frau in Afghanistan. Herb und rau die Landschaft, rigoros und hart das Leben – die Abgeschiedenheit schützt vor gewaltsamen Eingriffen und Verlusten nicht. Am Ende packt das ganze Dorf Sack und Pack, um vor herannahenden Soldaten zu fliehen. Der Krieg kennt keine Grenzen, keine Abgeschiedenheit. Ein eindrücklicher Film über Mythen, Menschen und Bedrohungen.
****°°
Die Geträumten
I.I. Der Briefwechsel einer «Amour fou» zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan in einem dialogischen Film von Ruth Beckermann. Ingeborg Bachmann (*1926 in Klagenfurt) lernt Paul Celan (*1920 in Czernowitz) in den Wirren des Nachkriegswien im Mai 1948 kennen. Bachmann studiert dort seit 1945 Philosophie, für Celan ist Wien eine Zwischenstation, im Juni 1948 geht er nach Paris. Ihr Briefwechsel ist zunächst spärlich, dann setzt er sich in immer neuen Episoden und dramatischen Phasen mit Unterbrüchen bis Ende 1961 fort, als die sporadischen persönlichen Begegnungen und Briefgespräche ganz abbrechen, da sich Celan Plagiatsvorwürfen ausgesetzt sieht und sich von Ingeborg Bachmann und Max Frisch, mit dem sie zu jener Zeit zusammenlebt, nicht unterstützt fühlt. Ein letzter Brief datiert vom Juni 1967, ein Ringen um Freundschaft als bewegendes Zeugnis einer Liebe, die nicht gelebt werden konnte. So hatte Bachmann über Celan einst geschrieben: «Ich habe ihn mehr geliebt als mein Leben». Unter dem Titel «Herzzeit» (Suhrkamp, 2008) wurden die Briefe als Buch veröffentlicht, die der österreichischen Regisseurin Ruth Beckermann und der Autorin Ina Hartwig als Grundlage für ihr Drehbuch unter dem Titel «Die Geträumten» (nach einem Zitat von Paul Celan) dienten. Ein Film, der den Originaltexten viel Raum und ihnen mittels zweier junger Protagonisten eine eindrückliche Stimme verleiht. Der Film beginnt mit Grossaufnahmen der Gesichter der Musikerin Anja Plaschg und des Burgschauspielers Laurence Rupp, die die herzzerreissenden Briefe lesen, die ab 1948 zwischen Wien und Paris hin und her gingen, manchmal auch von Bachmann nicht abgeschickt wurden. Paul Celan, der das Überleben nach Auschwitz grundsätzlich existentiell in Frage stellte, wählte 1970 den Freitod in der Seine. Ingeborg Bachmann durchlebte nach der Trennung von Max Frisch persönliche Krisen, die sie u.a. in «Todesarten» oder «Malina» thematisierte. Sie starb 1973 mit 47 Jahren an den Folgen eines Brandunfalls in Rom. Anders als im Buch «Herzzeit» wird im Film nicht erklärt, wann die Begegnungen in den verschiedenen Jahren stattfanden, was irritierend wirken kann, da sich die Briefe mehrheitlich auf gegenseitig verschobene Treffen konzentrieren und den schwer zu vereinbarenden Lebensentwürfen der als Dichter tätigen Schreibenden.
***°°°
Die Florence Foster Jenkins Story
rbr. Wahn und Wirklichkeit einer Sängerin. «Die Leute können vielleicht behaupten, dass ich nicht singen kann, aber niemand kann behaupten, dass ich nicht gesungen hätte.» Diese Selbstbehauptung steht auf ihrem Grabstein in New York. Sie verstarb im November 1944. Eigenartig, just jetzt gibt es eine kinematographische Wiederentdeckung der Sängerin, die weder Töne noch Rhythmus halten konnte. Die Amerikanerin Florence Foster Jenkins (1868-1944) hat drei Filmer zu Werken inspiriert. Im letzten Jahr war Xavier Giannolis Spielfilm «Madame Margurite oder Die Kunst der schiefen Töne» zu sehen. Er verlegte die Handlung nach Frankreich in die Zwanzigerjahre, Catherine Frot spielte die besessene Sängerin ganz passabel, aber wenig nachhaltig in unseren Kinos. Noch vor dem Kinostart von Stephen Frears Abhandlung «Florence Foster Jenkins» mit Meryl Streep (ab 24. November) kommt die deutsche Produktion «Die Florence Foster Jenkins Story» in unsere Kinos (ab 17. November). Die Amerikanerin Joyce DiDonato, gefeierter Star der Scala in Mailand, des Covent Garden in London oder der Metropolitan in New York, verkörpert das Bühnenphänomen Florence Foster. Nachhaltig. In seiner Doku-Fiction zeichnet Ralf Pleger entscheidende Szenen des Bühnenstars aus eigenen Gnaden nach – mittels Archivbildern und gespielten Szenen, die auf originalen Quellen basieren. Dazu werden fast beiläufig Statements diverser Experten eingebunden, Das opulente theatralische Drama, faszinierend in visueller und stimmlicher Umsetzung, ist eine filmische und künstlerische Entdeckung. Auch wenn Florence Foster Jenkins musikalisch in einer anderen eigenen Welt lebte und sich als extravagante Opernsängerin schier lächerlich machte – bis hin zur Carnegie Hall in New York – war sie doch auch eine multimediale Wegbereiterin mit ihren theatralischen Diva-Auftritten und Posen, den sogenannten Tableaux vivants, den lebenden Bildern. Eine tragische Figur «like a bird », wie sie selber sang.
****°°
Willkommen bei den Hartmanns
rbr. Ein Flüchtling als Therapie. Wenn Sentana Filmproduktion etwas verspricht, steckt auch ganz viel Senta drin, will heissen: Das tragikomische Familientechtelmechtel unter dem Titel «Willkommen bei den Hartmanns» wird von Senta Berger als weiblicher Gallionsfigur angeführt. Simon Verhoeven, ihr Sohn, schrieb das Buch und führte Regie. Ehemann beziehungsweise Vater Michael Verhoeven war ebenfalls an der Produktion beteiligt. Worum geht’s? In einer mehr als gutbürgerlichen Familie kriselt es: Der Patron, Richard Hartmann (Heiner Lauterbach), Chefarzt, hadert mit seinem Alter und dem Altern. Er möchte diesen Prozess am liebsten stoppen oder zumindest kaschieren. Seine Frau Angelika (Senta Berger), pensionierte Lehrerin, langweilt sich und möchte der Alltags- und Familienroutine entfliehen. Die Tochter Sophie (Palina Rojinski) ist auch mit 31 noch auf Selbstfindungskurs, studiert jetzt Psychologie und wird von ihrem leistungsorientierten Vater geplagt. Sohn Philip (Florian David Fitz) entpuppt sich als arroganter Businessmanager, der an Selbstüberschätzung krankt und seinen Sohn Basti (Marinus Hohmann) sträflich vernachlässigt. Wie ist dieser Familie noch zu helfen? Mit einem Flüchtling, meint die resolute Angelika. Dazu wird der Nigerianer Diallo (Eric Kabongo) auserkoren – gegen den Willen des mürrischen Doktors. Diallo wird zum Reibungspunkt, aber auch Mediator in dieser Krisengemeinschaft. Er erweist sich nicht nur als Bastis guter Kumpel, sondern auch als Amors Fürsprecher und seelische Stütze des Midlife-Krisenpatienten Hartmann. Dass sich nebenbei der vom Chef Hartmann getriezte Assistent Dr. Tarek Berger (Elyas M’Barek) und dessen flattrige Tochter Sophie zueinander finden – natürlich gegen den Willen des Vaters – und Schönheitsschöpfer Dr. Sascha Heinrich (Uwe Ochsenknecht) sein Fett abkriegt, versteht sich. Das namhafte Ensemble zieht am selben Strick und unterhält auf gutbürgerlichem Niveau. Auch wenn der Filmemacher Simon Verhoeven bisweilen über die Stränge schlägt und die meisten Figuren überstrapaziert karikiert – mit Ausnahme des Gutmenschen Angelika – hat seine Familienkomödie Pfiff und Pfeffer. Dabei setzt er durchaus ernst zu nehmende Zeichen in Sachen, Liebe, Nächstenliebe und Flüchtlingsdramatik. Simon Verhoeven ist Humanist und hat Humor. Das verträgt sich gut – auch bei einem heiklen Thema wie Flüchtlingsproblematik. Er meidet billige Ironie und zynische Spässe. Er weiss, dass er nicht auf jede Befindlichkeit Rücksichtnahme nehmen kann und will. Sein Film ist so widersprüchlich und ambivalent wie die ganze Problematik. Welcome!
****°°
Doctor Strange
rbr. Marvels Mystiker. Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht einer oder eine Handvoll Comichelden aus dem Marvel-Universum die Leinwand heimsuchen. Nun ist der Mystic-Doc aus New York an der Reihe: Der Neurochirurg Stephen Strange, boshaft arrogant und genial zugleich, verliert nach einem Unfall sein wichtigstes Handwerkzeug, sein Hände. Die Finger sind für Feinarbeit nicht mehr zu gebrauchen. Frustriert und traumatisiert, sucht er sein Heil im fernen Osten. In Nepal (Kathmandu) soll es ein Institut, Sekte oder geheime Magie-Gemeinschaft geben, die helfen könnte. «Die Älteste – The Ancient One» (Tilda Swinton) weist ihn den Weg der Magie, öffnet ihm den Blick für neue Dimensionen. Doctor Strange wird zum Wanderer zwischen den Welten. Natürlich gibt es auch Feinde, welche die Welt ins Chaos und Zeitlose stürzen wollen. Allen voran ein abtrünniger Schüler (Mads Mikkelsen) der Zen-Meisterin. Doctor Strange, der auf Gewaltlosigkeit schwört (in dieser Beziehung ganz Arzt), ist als Weltretter gefordert. Doch dazu muss er erst vom hohen Ross runter, seine Arroganz und Überheblichkeit ablegen. Regisseur Scott Derrickson entfacht ein fantastisches Universum, faltet ganze Städte zusammen, verdreht die Dimensionen und zieht alle Register der ganzen Effekte- und 3D-Orgel. Ein bisschen Psychedelic und Philosophie ist auch dabei. Erträglich macht diese Fantasy-Orgie vor allem Benedict «Holmes» Cumberbatch als Strange, der mal süfffisant-ironisch, mal esoterisch-verschwörerisch agiert und kommentiert. Der bombastische Budenzauber im Marvel-Theater ist trotz Pseudo-Tiefgang auf Dauer (115 Minuten) ermüdend.
***°°°
Cézanne et moi
rbr. Ende einer Freundschaft. Sie waren sich nah, sehr nah, der labile, dazumal verkannte Maler Paul Cézanne und der erfolgreiche Schriftsteller Émile Zola. Der eine kam aus vermögendem Haus, der andere aus ärmlichen Verhältnissen. Sie kannten sich schon als Kinder, verlebten unbeschwerte Sommer im Süden Frankreichs. Doch das ländliche Aix-en-Provence wurde ihnen als junge Erwachsene zu eng, es zog sie nach Paris. Paul Cézanne (Guillaume Galliene) und Émile Zola (Guillaume Canet) verkehren in Montmartre-Künstlerkreise, mit den Malern Auguste Renoir, Edgar Degas oder Camille Pissaro. Sie distanzieren sich von der etablierten, spiessigen Gesellschaft in der Provinz. Dabei sind sie nicht auf Rosen gebettet. Aber die Kunst und die Leben haben für sie mehr Gewichtung. Beide lieben dieselbe Frau: Alexandrine (Alice Pol), genannt Coco, die dann letztlich Zolas Frau wurde. Der Schreiber war erfolgreich als Journalist, dann als Schriftsteller, der seinem Freund Cézanne immer wieder moralisch und finanziell unter die Arne griff. Eine schier unerschütterliche, tiefe Freundschaft, die beide befruchtete, bis 1886 Zola in seinem Buch «Das Werk», Teil seines 20-bändigen Romanzyklus «Les Rougon-Macquart», einen gescheiterten Maler beschrieb. Den Schuh zog sich Cézanne an und war zutiefst beleidigt. Er erkannte in der Romanfigur sich selbst und zerschnitt die Freundschaftsbande abrupt. So haben sich die beiden zeit ihres Lebens nicht mehr gesehen und gesprochen. Auch wenn Zolas Liebe zu Cézanne eigentlich nie erloschen ist. Auch das zeigt das Freundschaftsdrama «Cézanne et moi». Regisseur und Drehbuchautor Danièle Thompson konzentriert sich auf diese intensive brüderliche Verbundschaft. Er drehte an Originalplätzen wie Moulins, in der Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Aix-en-Provence, wo Cézanne geboren wurde. Natürlich darf auch das berühmte Malmotiv für Cèzanne oder Van Gogh nicht fehlen, der Mont Ventoux. Thompson gelingt es brillant, die landschaftliche, aber auch menschliche Stimmung (der beiden Freunde/ Widersacher) zu zeichnen – geradezu impressionistisch, malerisch in den Farben. Ein intimes (nie schulmeisterlich akademisches) Porträt über zwei Kulturheroen Frankreichs – von A wie Aix-en-Provence bis Z wie Zola sehenswert.
****°°
Café Society
I.I. Woody Allen (80) ist wieder da. Diesmal mit einem wunderschön fotografierten Epos über das Hollywood der 1930er Jahre mit Stars und Oldtimern. Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg) wächst in der New Yorker Bronx in einer chaotischen jüdischen Familie auf, fühlt sich aber zur Glitzerwelt Hollywoods hingezogen, wo sein Onkel Phil (Steve Carell) als berühmter Filmagent tätig ist. Bobby beginnt in Los Angeles als Botengängers seines Onkels und lernt dessen attraktive Sekretärin Vonnie (Kristen Stewart) kennen, in die er sich Hals über Kopf verliebt, ohne zu wissen, dass es auch die grosse Liebe seines Onkels ist. Damit beginnen die für Woody Allen typischen Verwicklungen, die mit lakonischem Witz aus dem Off von Allen kommentiert werden, was zu vergnüglichen komödiantischen Einlagen führt, die dem Film eine charmante Note von Champagnerlaune, Jazz und Reichtum verleihen. Als Bobby nach enttäuschter Liebe wieder nach New York zurückkehrt, überstürzen sich die Ereignisse, weil sein Bruder Ben (Corey Stoll) bei Mafia-Geschäften nicht einmal vor Mord zurückschreckt. Woody Allens bester Film seit langem.
****°°
«Mapplethorpe – Look at the Pictures»
I.I. Robert Mapplethorpe schockierte in den Siebziger- und Achtzigerjahren mit erotischen Darstellungen von Homosexualität und stieg schnell zum Shootingstar der New Yorker Kunstszene auf. Der Amerikaner, aufgewachsen in einer wohlhabenden Familie in einem konservativen Vorort auf Long Island, beginnt noch während eines Kunststudiums sein ausschweifendes Leben in der New Yorker Underground- und Fetisch-Szene filmisch zu dokumentieren. Es ist die Zeit von Andy Warhols Factory von Disco-Rock und offen zur Schau gestellter Sexualität. Mit der Sängerin Patti Smith beginnt Mapplethorpe die New Yorker Kunstszene aufzumischen und zu erobern. Seine skandalumwitterten Fotos wurden stilprägend für die moderne Fotografie; Mapplethorpe (1946-1989) porträtierte auch Stil-Ikonen wie Grace Jones, Patti Smith oder Modedesignerin Carolina Herrera sowie zahlreiche Designer. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität erkrankte Mapplethorpe an Aids. Zu der Zeit beginnt sich auch die amerikanische Polizei für seine äusserst freizügigen Arbeiten zu interessieren. 25 Jahre nach seinem Tod würdigt ein Dokumentarfilm von Fenton Bailey & Randy Barbato Mapplethorpes Schaffen und gewährt einen unvergleichlichen Einblick in einen Fundus mit Fotos, Interviews und Lebenserfahrungen zahlreicher Personen aus seinem Umfeld, wie u.a. Brooke Shields, Gloria von Thurn und Taxis, Edward Mapplethorpe.
****°°
The Accountant
I.I. Ein zielsicherer Buchhalter dreht durch. Bei Tage ist Chris Wolff (Ben Affleck) ein harmloser Steuerberater mit eigenem Büro, doch in Tat und Wahrheit arbeitet er für Mafiabosse und wäscht ihr Geld für internationale Verbrecherorganisationen, weshalb ihm die US-Steuerbehörde auf den Fersen ist. Der kurz vor der Pensionierung stehende Steuerfahnder Raymond King (J.K. Simmons) hat Verdacht geschöpft und setzt die junge Analytikerin Marybeth Median (Cynthia Addai-Robinson) mit nicht blütenreiner Vergangenheit auf den Fall an und droht bei einer Absage, ihre kriminelle Vergangenheit zu enttarnen. Als autistisches Rechengenie, dem in seiner Kindheit von einem militärischen Beamtenvater jegliche Emotionen abtrainiert wurden, lebt Wolff ein einsames Leben. Wolff ist ein Wolf im Schafspelz und hat über Scheinfirmen riesige Vermögen angehäuft, ausserdem ist er ein Waffennarr und räumt kurzerhand jeden aus dem Weg, der ihm in die Quere kommt. Eine gefährliche Mission, die Median zu erledigen hat. Als Wolff seine Verfolgerin durchschaut, wird’s brandgefährlich. Dank einem beeindruckenden Ben Affleck bleibt der Film trotz einiger Winkelzüge bis zuletzt spannend. Regie: Gavin O’Connor.
***°°°
Bridget Jones’ Baby
I.I. Bridget Jones – Hallo again! Ihre Beziehung mit Mark Darcy (Colin Firth) ist längst in die Brüche gegangen, seither konzentriert sich Bridget Jones (Renée Zellweger) auf ihre Karriere als Produzentin. Sie geniesst ihr Singleleben und umgibt sich mit alten wie auch neuen Freunden. Zum ersten Mal in ihrem Leben scheint die Chaotin alles im Griff zu haben – bis sie eine Begegnung mit dem charmanten Amerikaner Jack Qwant (Patrick Dempsey) aus dem Gleichgewicht bringt. Es funkt zwischen ihnen und die beiden verbringen eine Nacht miteinander. Und nur eine Woche später lässt sich Bridget spontan auf ein weiteres Techtelmechtel ein, mit ihrem Ex Mark. Das wäre alles nicht so wild, wenn sie nicht ein paar Monate später feststellen würde, dass sie schwanger ist und ihre Ärztin (Emma Thompson) keinen blassen Schimmer hat, von wem der Nachwuchs stammt. Die jeweils als Papa infrage kommenden Herren stört das nicht, sie buhlen beide um Bridget. Auch wenn einige Bridget Jones schon ein Verfalldatum attestieren, ist der Film dank Renée Zellweger, die nach zwölf Jahren erschlankt auf der Leinwand erscheint und bald darauf schwanger wird, eine amüsante Feelgood-Komödie, nicht zuletzt dank ihren Filmpartnern Colin Firth und Patrick Dempsey, die als werdende Väter äusserst agil agieren. Regie: Sharon Maguire.
***°°°
Girl On The Train
rbr. Perfider Psychothriller. Sie sitzt im Zug, genauer in der Metro-North Hudson Line, von Ardsley-on-Hudson, einem Kaff in der Umgebung von New York, nach Manhattan. Täglich. (Im Bestsellerroman von Paula Hawkins ist London er Schauplatz). Rachel Watson (Emily Blut), geschieden, vereinsamt, entwurzelt, arbeitslos, beobachtet Menschen, die förmlich an ihr vorüberziehen. Dabei saugt sie die vorbeihuschenden Passanten geradezu auf und spinnt deren Geschichte weiter. Rachel verbeisst sich in diese «Schattenwesen», speziell in ein Liebespaar, Megan (Haley Bennett) und Scott (Luke Evans). Eines Tages entdeckt sie, dass die blonde Megan verschwunden ist. Rachel, die Trost im Alkohol sucht, wurde von ihrem Mann Tom (Justin Theroux) verlassen, der inzwischen mit der neuen Frau Anna (Rebecca Ferguson) ein gemeinsames Baby hat. Rachel steigert sich Wahnbilder, auch weil sie Gedächtnislücken und an eine verhängnisvolle Nacht nur Erinnerungsfetzen hat. Hat sie etwas mit Megans Verschwinden, einem Mord zu tun? – Der verzwickte, künstlich verschlungene Psychothriller um drei Frauen, fiese Männer und Fallen kommt nur mühsam in Fahrt, er führt den «unwissenden» Zuschauer an der Nase herum. Erst gegen Ende legt er zu und entfaltet eine Meisterschaft. Die Entwicklung wirft alle Erwartung über den Haufen (und hat eine ferne Verwandtschaft mit Hitchcocks «Fenster zum Hof»). Wer inszenierte Rätsel und Täuschungsspiele mag, wird von Tate Taylor bestens bedient. Die Bestsellerverfilmung hat vor allem ein Glanzlicht, und das ist Emily Blunt als besessene, trunksüchtige und manipulierte Frau, die auf sich selbst zurückgeworfen wird.
****°°
La Danseuse
rbr. Atemberaubend. Sie ist stämmig und kräftig gebaut – Tochter eines amerikanischen Rodeoreiters – und alles denn ein Tanzmodell. Als ihr recht wilder Vater in einer Badewanne auf der Wiese erschossen wird, packt sie ihre Habseligkeiten und reist nach New York. Loië Fuller bezirzt auf ihre burschikose Weise den Adeligen Comte Louise (Gaspard Ullie) und besorgt sich das Geld für die Europareise. Man schreibt das Jahr 1982. Verbissen, ehrgeizig, hartnäckig, ja geradezu missionarisch will sie in Paris ihre Tanzvisionen verwirklichen. Tatsächlich kann sie sich Auftritte in den Folies Bergère ergattern und begeistert mit ihrer revolutionären Performance. Ihr Serpentinen- oder Derwischtanz, eingehüllt in massenweise Seide und ausgestattet mit verlängerten Armen, bietet sie eine phantastische Augenweide. Ihre Darbietung hat nichts mit klassischer Tanzschule zu tun, wohl aber mit Licht und Inszenierung. Doch ihrem totalen Körpereinsatz und dem gleissenden Licht muss sie Tribut zahlen. Mütterlich, liebevoll und selbstlos unterstützt von Gabrielle (Mélanie Thierry), geht sie bis zum letzten, fast bis zum letzten Atemzug. Verliebt in die 15 Jahre jüngere grazile Tänzerin Isadora Duncan (Lily-Rose Depp), wird sie von der Konkurrentin «verraten». Die revolutionäre Tanz-Pionierin Loië Fuller hat tatsächlich gelebt (1862-1928) – grandios verkörpert durch Soko. Mit «La Danseuse» schuf Stéphanie di Giusto zwar eine faszinierende Tanzperformance und ein melodramatisches Beziehungsdrama, doch kein vertiefendes Porträt der legendären Loie. Diese Künstlerin hat die Technik (Licht, Projektionen und mehr) erstmals als stilbildendes Element auf die Bühne gebracht. Die Beziehungen zum Comte wie auch zur skrupellosen Konkurrentin Isadora bleiben jedoch vages Beiwerk und dramatischen Zunder. Loië ist eine Pionierin multimedialer Künste. Das zeigt der Film berauschend.
****°°
American Pastoral
rbr. Verlorene Tochter. Die Geschichte spielt zwar Ende der Sechzigerjahre in New Jersey, ist jedoch gerade heute wieder brandaktuell. Eine Tochter aus gutem Haus bricht aus und radikalisiert sich. Zeit des Vietnamkriegs. Im Roman «American Pastoral» (Pulitzerpreis 1998) von Philip Roth erlebt ein Elternpaar, wie ihre Tochter für ein Attentat 1968 auf eine Tankstelle im Ort die verantwortlich gemacht wird. Die verdächtige Täterin Merry (Dakota Fanning) taucht unter. Der Vater Seymour «Swede» Levov (Ewan McGregor) gibt nicht auf und sucht Merry sein Leben lang. Die Mutter (Jennifer Connelly) versucht sich von der Vergangenheit zu lösen und hakt die Tochter ab. Diese ganze tragische Entwicklung kommt zum Vorschein, als der Schriftsteller Nathan Zuckerman (David Strathairn) beim Klassentreffen (45 Jahre nach dem Abschluss) vom Bruder des einstigen Schulstars «Swede» Levov erfährt, was dem erfolgreichen Sonnyboy passiert ist. Schauspieler Ewan McGregor war sehr erpicht darauf, den Helden des Roth-Romans selber zu spielen und Regie zu führen. Das Martyrium eines Vaters bildet den Kern dieses Drama, die Tochter wie auch deren Mutter bleiben dagegen Randfiguren. So werden Merrys Beweggründe und Werdegang nur vage angedeutet. Sie verkommt zu einer verlumpten «Weltretterin», die dann gegen Ende ihrem Vater die «Ehre» erweist. Wenn man dem Titel «American Pastoral» auf den Grund geht, hat er wenig mit kirchlicher Handhabe, wohl aber mit Seelsorge, also mit Sorge um die Seele zu tun. Ergreifend und aktuell. Antworten findet man nicht, wohl aber Verständnis für die Opfer.
****°°
Wild Plants
rbr. Zurück zur Natur, zur Erde. Urban Gardening ist ein Begriff, der nur einen Teil eines Trends beschreibt. Zurück zur Natur, das heisst zum Bio-Gemüse oder –Frucht, zum ursprünglichen Geschmack, der nicht nur bei Tomaten verwässert und neutralisiert wurde, zur Natürlichkeit und zum Eigenanbau. Der deutsche Filmer Nicolas Humbert («Wanted Hanns Eisler») hat sich auf Spurensuche gemacht. «Wild Planets» meint Gewächse, die sich auf Brachland aussamen, quasi ein altes neues Territorium erobern und neue Lebensräume schaffen. Gemeint sind aber auch Menschen, die ihre eigenen «grünen» Utopien angehen und schaffen – und das ist ganz irdisch, erd- und naturnah gemeint. Humbert hat eine fantastische, aber wahrhaftige Forschungsreise unternommen zu Land und Leuten – ganz bodenständig und wildwüchsig – von Zürich bis Detroit, von der indianischen Reservation Pine Ridge bis zu den Jardins de Cocogne in Genf. Insidern ist er bekannt, der Zürcher «Stadtwilderer» Maurice Maggi, der sozusagen undercover Samen ausstreut, öde Stellen und Plätze in der Limmatstadt zum Blühen bringt. Kinga Osz und Andrew Kemp beleben auf ihre Weise die marode, verfallenden Automobil-Metropole Detroit. Sie beackern als Urban Gardener brache Flächen mit dem Ziel sich selbst zu versorgen. Das Gartenkollektiv Les Jardins de Cocagne in Genf entwickelt alternative Wege des Gartenbaus. Der indianische Aktivist Milo Yellowhair versucht in Pine Ridge alte Anbauweise zu retten, die traditionelle, auch zeremonielle Pflanzenverwendung wach zu halten. Sie alle wollen das Bewusstsein für die kultivierte und nutzbare Natur schärfen, leben mit der Erde, dem Grund und Boden, statt ihn total auszubeuten und zu zerstören. Die Begegnung mit den «neuen Wilden», die gegenüber der gedankenlosen Konsum und Komfort der Gesellschaft Alternativen entwickeln und realisieren, ist spannend wie aufschlussreich und jedem Umweltverantwortlichen, jeder Schulklasse zu empfehlen.
****°°
Nebel im Herbst
rbr. Opfer der Euthanesie. Er zählt just mal 13 Jahre und wird in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Ernst Lossa ist jung, rebellisch, unangepasst und Fahrender eben Zigeuner. Als schwer erziehbar abgestempelt (der Vater hat zudem keinen festen Wohnsitz), entspricht er nicht der nationalsozialistischen Rassenideologie. Man schreibt das Jahr 1942. Ernst versucht sich in dieser bayrischen Heil- und Pflegeanstaltswelt, die sich den Anstrich humanitärer Fürsorge gibt, zu behaupten. Er ist auffällig, und dem Anstaltsleiter Dr. Walter Veithausen (Sebastian Koch) ist er auf Dauer ein Dorn im Auge, ein Widersacher, ein Störenfried – und die sind eben zu eliminieren. Ernst versucht, schwächeren Insassen wie Oja (David Bennent) zu helfen, freundet sich mit Nandl (Jule Hermann) an und will mit ihr fliehen. Schwester Sophia (Fritzi Haberlandt) durchschaut das mörderisch-medizinische Spiel, das Veithausen und sein «Todesengel» (Henriette Confurius) mit den Patienten treiben, widersetzt sich und stirbt. Es ist ein grausames Schauspiel, das uns dezent, aber desto wirksamer vor Augen geführt wird. «Es muss wieder mehr gestorben werden», heisst es einmal lapidar. Und dann gibt der Anstaltsleiter bei einer Nazi-Sitzung folgenden Spruch stolz zum Besten: «Sie verhungern beim Essen». Denn er lässt in seiner Anstalt Suppen verteilen, die ausgekocht sind und deshalb keinerlei Ernährungswert mehr haben. Mit «Nebel im August» hat Kai Wessel einen erschütternden Film über die Nazi-Euthanasiepraxis geschaffen – nach dem gleichnamigen Tatsachenroman (2008) von Robert Domes. Ernst Lossa hat wirklich gelebt, gelitten und ist 1944 gestorben. Ivo Pietzcker verkörperte den Jungen im Räderwerk menschenverachtender, nationalsozialistischer Vernichtung – unglaublich authentisch und ergreifend. Ein Drama, das unter die Haut geht und das man so leicht nicht mehr vergisst.
*****°
Ma Loute
rbr. Eine schrecklich schräge Familie. Ferien an der Normandie im Sommer 1910. Rauer Atlantik, unberührter Strand, wilde Dünenlandschaft, sumpfiges Hinterland. Hier an der Bai de la Slac, rackern sich Fischerfamilien wie die Bruforts ab. Der Vater, seine drei jüngeren Söhne und der ältere, Ma Loute (Brandon Lavieville), suchen mühsam Miesmuscheln zusammen oder betätigen sich als Fährmann. Meistens zu Fuss, das heisst: Vater und Sohn Ma Loute tragen Passanten auf starken Armen über Bäche und Flussarme. So auch die herrschaftlichen Sommergäste der Van Peteghems. Zwei verschiedene Welten – hier die armselige Küstenbewohner, dort die snobistisch Feriengäste auf einem Landsitz. Das mysteriöse Verschwinden von Urlaubern hat die Polizei aus Calais auf den Plan gerufen, den Inspektor Alfred Machin (Didier Després), dick und unförmig wie ein Mehlsack und fähig wie ein Amtsschimmel sowie sein dienende Assistent Malfoy (Cyril Rigaux), mehr Steigbügelhalter denn Ermittler. Der Zuschauer erfährt bald beiläufig, wohin die Verschwundenen gelandet sind (aber das sei hier nicht verraten). Überhaupt muss man auf einige skurrile, auch brutale Überraschungen gefasst sein. Die ganze versnobte, halbadelige Familie Van Peteghem wirkt wie eine Karikatur, Jeder hat eine Macke, einen Tick: der Patron André (Fabrice Luchini), seine Frau Aude (Juliette Binoche), seine Schwester Isabelle (Valeria Bruni Tedeschi), die offenbar gleichzeitig seine Cousine ist, wie auch Onkel Christian Van Peteghem (Jean-Luc Vincent). Nicht zu vergessen Teenager Billie (Raph) – Boy oder Girl ist hier die Frage. In ebendiese flatterhafte Person verliebt sich der Bursche Ma Loute Brufort. Bruno Dumont hat eine aberwitzige, absurd-groteske und doch rau-wirkliche Familienkomödie angezettelt, die auch eine Liebesgeschichte birgt. Selten war im Kino eine derart schräge, schrullige, auch idyllische Krimi- und Gesellschaftsfarce zu sehen wie «Ma Loute» – mit Staraufgebot, herben Darstellern und eine spezielle Himmelfahrt.
****°°
Don’t Call Me Son
rbr. Fatale Familienfindung. Eine tragische Entwicklung: Der 17jährige Pierre (Naomi Nero) lebt sich aus, spielt in einer Band, liebt Frauenkleider und schminkt sich gerne. Seine Mutter lässt ihm alle Freiheit. Doch eines Tages gerät sein Leben aus den Fugen: Seine Mutter hat ein falsches Spiel angezettelt, sie hat ihn als Baby vor 17 Jahren einer andere Familie geklaut, ebenso wie seine Schwester Schwester Jacqueline. Pierres leibliche Eltern (Dani Nefusi und Matheus Nachtergaele) haben nie locker gelassen, ihren verlorenen Sohn zu finden. Sie sind glücklich und wollen ihren Sohn in ihrer Familie einschliessen. Nur, der will nicht, bockt. Der Filmtitel «Don’t Call Me Son» unterstreicht die Haltung Pierres, der eigentlich Felipe heissen sollte. Anna Muylaert, Autorin und Regisseurin, hat einen tatsächlichen brasilianischen Fall aufgegriffen und beschreibt sehr nah an den Figuren ihre Haltung und Empfindungen. Das Familien- und Persönlichkeitsdrama aus Brasilien macht sich stark für individuelle Entscheidungen und Identität, die nicht auf Kommando oder Dokumenten entsteht, sondern auf Gefühlen, Erfahrungen und Zuneigung beruht. Eine schöne versöhnliche Geste am Schluss markiert Pierres Entscheidung: Sein leiblicher Bruder Joca (Daniel Botelho) hat Verständnis für ihn. Sie umarmen sich.
***°°°
Hell Or High Water
rbr. Gangsterballade im Stil eines Western. Texas war einst ein beliebter Westernschauplatz. Das war einmal. Aber rau, wild und gewalttätig ist es geblieben, das Land zwischen Prärie und Ölfeldern. Und hier hat David Mackenzie sein Bankräuberdrama angesiedelt: Tanner Howard (Ben Foster) ist just aus dem Knast entlassen worden und wird von seinem Bruder Toby (Chris Pine) in Empfang genommen. Ihre Mutter hat ihnen eine Farm vererbt, doch die ist verschuldet, und die Bank kennt kein Pardon. Der Grundbesitz soll zwangsversteigert werden. Der rabiate Tanner sieht nur eine Lösung: Das Problem an der Wurzel packen und sich das nötige Geld bei den Schuldnern holen, heisst die Banken zur Kasse «bitten». Also beginnen Tanner und Toby bestimmte Geldinstitute in der Umgebung auszurauben. Dem Räuberpaar ist ein Texas Ranger samt indianischem Gehilfen auf den Fersen: Der alte Marcus Hamilton (unnachahmlich sarkastisch und entspannt Jeff Bridges) ist ein harter Hund und will’s noch einmal wissen – vor seiner Pensionierung. Die Story ist einfach gestrickt, fast absehbar und doch packt diese Ballade eines Robin-Hood-Paars zum eigenen Vorteil ungemein. Die beiden Texaner beantworten Ausbeutung (der Banken) mit Gegengewalt. Doch in David Mackenzies melancholischem Thriller im Westernstil geht es weniger um Waffen- und Gewaltproblematik, mehr um Familiensolidarität und Bruderschaft. «Hell Or High Water» – gemeint ist mit der Redensart «Come hell or high water» ein gewisser Fatalismus, eben egal was kommt ob Hölle oder Hochwasser – ist eine Kinoentdeckung, in Cannes wie nun auch in den US-Kinos (der erfolgreichste Independent-Film des Jahres). Die Akteure, die Schauplätze, gedreht wurde vorwiegend in New Mexico, und Musik (Nick Cave und Warren Ellis) machen diese moderne Texas-Ballade zu einem Meisterwerk.
*****°
Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children
rbr. Insel der besonderen Kinder. Tim Burton ist bekannt für skurrile, andersartige Phantasieprodukte – beispielsweise «Beetlejuice», «Batman» oder «Edward Scissorhands». Nun hat er sich des Jugend-Fantasyromans von Ransom Riggs angenommen: «Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children» oder eben «Die Insel der besonderen Kinder». Der 16-jährige Jake (Asa Butterfield) folgt den Spuren seines Grossvaters, der ihm von ausserordentlich begabten Kindern und Monstern erzählt hat. Tatsächlich findet Jake auf einer Insel vor Wales besagtes Heim. Möglich wurde dies, weil er selber eine besondere Begabung besitzt und in eine Zeitschleife eindringen konnte. Man schreibt das Jahr 1943, exakt den 3. September 1943, dem Tag, an dem deutsche Bomber ihr tödliche Last über dem Heim abladen werden, in dem die Kinder leben. Sorgsam hütet und behütet Miss Peregrine (Eva Green, das Bond-Girl aus «Casino Royale») ihre Zöglingen im abgelegenen Herrschaftshaus und achtet darauf, dass man in der Zeitschlaufe verweilt, um nicht Opfer der Bomben zu werden. Jake begegnet also Kindern mit ausserordentlich Kräften und Eigenschaften – wie dem unsichtbaren Millard, der übermenschlich starken Browyn Buntley, dem visionären Horace, dem Sonderling Hugh mit Bienen im Bauch, den maskierten Zwillinge oder der feurigen Emma, in die sich Jake verguckt. Aber die sonderliche Gemeinschaft ist in Gefahr. Sogenannte Hallows – augenlose unsichtbaren Kreaturen, die den Kindern nach den Augen trachten – greifen sie an. Drahtzieher ist ein gewisser Mr. Barron (Samuel L. Jackson), ein Wissenschaftler, der andere Gestalt annehmen kann, und Miss Peregrine entführt. Nur Jake ist in der Lage, die Hallows zu sehen, er ist die letzte Hoffnung für die Armbrustschützin Peregrine und die Waisenkinder. – Regisseur Tim Burton konnte aus dem vollen Phantastischen schöpfen und tat dies mit grosser Freude. Die Effekte sind grandios sowohl bei den Actionsequenzen als auch in den eher stillen stimmigen Momenten. Eva Green als Miss Peregrine ist eine Idealbesetzung, sie wirkt dämonisch und fürsorglich zugleich. Dazu haben Kostüm- und Maskenbildner exzellente Arbeit geleistet. Auch wenn die Story verzwickt scheint, macht es Spass, sich auf diese märchenhafte Zeitreise zu begeben. Die dunkle Reise mit Horroreinlagen, aber auch emotionellen Intermezzi bietet grosses Schauvergnügen. Man mag bisweilen an die Filmreihe der «X-Men»-Reihe erinnert werden, doch Burtons Fantasy-Trip weist weit mehr Qualitäten auf und trumpft mit vor allem mit dem Burton-Stil auf. Kein Kinderfilm, aber ein Kinovergnügen auch für Teenager. Fortsetzungen sind denkbar, hat Ransom Riggs doch zwei weitere Bücher veröffentlich: «Hollow City: The Second Novel of Miss Peregrine’s Cildren» (Die Stadt der besonderen Kinder) und «Library of Souls: The Third Novel of Miss Peregrine’s Peculiar Children» (Die Bibliothek der besonderen Kinder). Der Name Peregrine leitet sich übrigens vom lateinischen Begriff peregrinus ab, der wissenschaftliche Name für Wanderfalken, in den sich Miss Peregrine verwandeln kann. In einer Nebenrolle hat Judi Dench einen Auftritt als Leiterin des Miss Avocet’s Home for Peculiar Children.
****°°

