

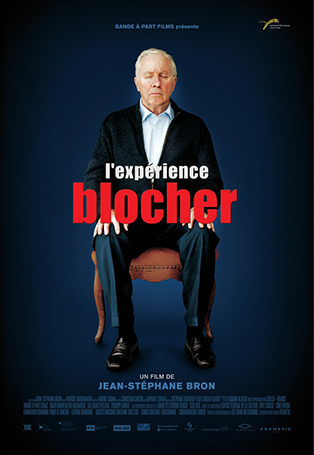


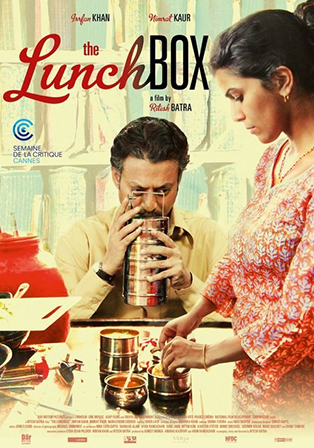



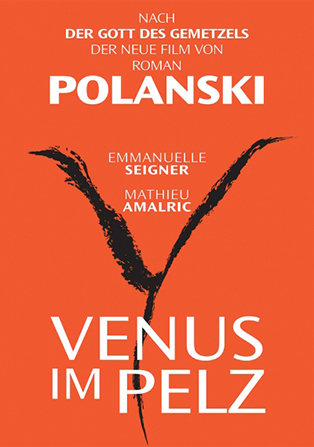


«Am Hang: Tiefgründige Verwirrspiele»
Von Rolf Breiner
Das Zurich Filmfestival rief und fast alle kamen – Stars, Schauspieler, Mitwirkende, Filmer und Produzenten. So auch Martina Gedeck und Partner Markus Imboden, die ihren Film «Am Hang» vorstellten, eine Romanverfilmung, die ausser Konkurrenz Gala-Premiere in Zürich feierte. Ferner ein Interview mit Jean-Stéphane Bron über seinen Dokumentarfilm «L’expérience Blocher» sowie aktuelle Filmtipps.
«Am Hang»
Das Buch «Am Hang» des Schweizers Markus Werner aus dem Jahr 2004 wurde zum Bestseller (Fischer Verlag). Marcel Reich-Ranicki lobte den Autor als «glänzenden, unterhaltsamen und lebensklugen Erzähler». Kein Stoff im Vergleich zu den Büchern eines Martin Suter, dessen Bücher sich geradezu zur Verfilmung anbieten. Werner dokumentiert und analysiert die Geschichte zweier Männer zu einer Frau, wobei Ehemann und Lover, die sich in einem Tessiner Hotel kennenlernen und ins Gespräch kommen, nicht wissen, dass es sich bei ihren Gedankenaustausch um dieselbe Frau handelt. Ein intimes literarisches Drama, das vom Schweizer Regisseur Markus Imboden auf die Leinwand gebracht wurde – mit seiner Partnerin Martina Gedeck als Imagination «Valerie». Sie haben sich 1997 bei den Dreharbeiten zu einer «Bella Block»-Folge kennengelernt und sind seit 2005 ein Paar, die Münchner Schauspielerin Martina Gedeck und der Regisseur aus Interlaken, Markus Imboden («Der Verdingbub»). Der Film «Am Hang» ist ihre achte filmische Zusammenarbeit. Ein Gespräch über Literatur und Film, Darstellen und Schauplätze.
Interview Martina Gedeck/Markus Imboden
Wie sind Sie zu diesem Stoff gekommen, wo war der Ausgangspunkt?
Markus Imboden: Die Initiative kam von der Produzentin Brigitte Hofer. Man hat mir das Drehbuch geschickt, ich hab’s gelesen und fand es gut. Den Roman kannte ich nur vom Hörensagen. Ich habe dann natürlich zum Buch gegriffen und nachgeschaut, ob im Drehbuch viel verpasst worden und nicht drin ist.
Ich habe zuerst Ihren Film gesehen und dann das Buch «Am Hang» gelesen und war verblüfft und mich gefragt: Wie kann das Buch in Bildern umgesetzt werden? Wie haben Sie das geschafft?
Markus Imboden: Der Roman hat seine eigenen Gesetzmässigkeiten. Der Leser stellt sich die Wirklichkeit im Kopf zusammen. Ich fand es einen interessanten Stoff, weil es ein Männerfilm ist, wo sich Männer unterhalten über Liebe, Gefühle und Emotionen und Verluste. Männer gibt’s ja meistens als komische Menschen – als Rennfahrer, Actionhelden, Machos…
…oder als Til Schweiger
Markus Imboden: …oder als Til Schweiger. Es schien mir interessant, dass Männer sich ernsthaft über Liebe und ihr Verhältnis dazu unterhalten.
Die Frau im Roman, Bettina/Valerie, bleibt imaginär, wird von den Männern erwähnt, rudimentär beschrieben und wird im Film real.
Markus Imboden: Über kurz oder lang kommt man nicht umhin, sie zu zeigen. Das Buch spielt mit etwas, was im Film gar nicht funktioniert.
Wann kam Martina Gedeck als Darstellerin ins Spiel?
Markus Imboden: Zuerst habe ich Henry Hübchen angefragt.
Martina Gedeck: Henry wurde besetzt und hat etwas Zeit gebraucht, sich zu entscheiden. Dann kam ich ins Spiel – im Film als Ex-Partnerin des Ehemanns.
Markus Imboden: Es ist eine ideale Rolle für Martina, finde ich. Wichtig scheint mir, dass beide Lieben sowohl vom Alten als auch vom Jüngeren glaubwürdig werden.
Zwei Männer, der eine Philosophielehrer, der andere Anwalt – und eine Liebe?
Martina Gedeck: Es geht nicht nur um zwei unterschiedliche Formen der Liebe, sondern auch um zwei unterschiedliche Generationen. Der Ältere ist aus der Analogwelt, das heisst: er glaubt an die Ehe und den Bestand einer Beziehung. Der Jüngere steht für die neue Zeit – keine Bindung, flexibel und beweglich sein, sich nicht festlegen. Dadurch wird auch der gesellschaftspolitische Aspekt stärker angesprochen: Wie kann man im diesem Flexibel-Bleiben noch Liebe oder Bestand finden?
Was treibt die beiden sehr unterschiedlichen Männer?
Martina Gedeck: Es ist Sehnsucht und Angst des einen vor der Einsamkeit, vor der Leere; die Angst des andern liegt darin begründet, seine Macht zu verlieren, ohnmächtig zu sein und abgelehnt zu werden. Dabei bietet die Frau Projektionsfläche, insofern ist es für die Zuschauer auch nicht so wichtig, wann er herausfindet, dass es bei beiden Männern um dieselbe Frau geht.
Wie sind Sie daran gegangen, diese imaginäre Valerie darzustellen?
Martina Gedeck: Ich musste anders andocken, ich werde ja peripher erzählt. Ich musste mein eigenes Zentrum finden, und das ist ihre Krise, ihre Krankheit, die dazu führt, dass Valerie ihr Leben radikal verändern will. Es gab diese Sequenz, wo sie sagt: Wenn ich die Krankheit überlebe, muss alles anders werden. Und das tut sie auch: Sie bricht aus. So verändert sich auch ihr Verhältnis zum Ehemann, zum Mann überhaupt. Dabei geht es ihr nicht darum, den einen gegen den anderen zu tauschen. Es geht ihr darum, etwas zu tun, was sie bisher nicht getan hat: etwas Verbotenes.
Ist dieser Bruch ein Akt der Befreiung?
Martina Gedeck: Genau.
Der Roman ist ein philosophischer, auch psychologischer Exkurs. Der Film beschreibt die Geschichte einer zerbrochenen Liebe und einer grossen Verletzung. Was stand für Sie im Vordergrund?
Markus Imboden: Das stimmt, ich könnte es nicht besser sagen. Die Krise des Mannes, der Hauptfigur, ist interessant. Der Mann ist verzweifelt, die bisherige Ordnung fehlt, die Ehe, das Nach-Hause-Kommen, das Fehlen der Sicherheit, das Vertrauen. Das stürzt ihn in eine Krise, wo er nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Er wird zum Stalker, bedrängt seine Frau. Und für die Frau wird es die Geschichte einer Ablösung, einer Befreiung.
Wie verhält es sich mit dem Liebhaber? Erlebt er nicht auch eine Krise?
Markus Imboden: Dieser Anwalt ist sicher oberflächlich, sehnt sich aber auch nach Liebe. Die lustvolle Aktion ist eben oberflächlich, dahinter steckt auch der Mangel in sich selber. Und das verspürt er im Diskurs mit dem Alten.
Wie würden Sie den Film beschreiben, annoncieren – als Liebesfilm, Psychodrama oder Thriller?
Markus Imboden: Es hat Aspekte von allem. Eine Liebesgeschichte ist meistens dramatisch und spannend. Vielleicht ein Liebesthriller.
Der literarische Schauplatz Cademario im Tessin kam nicht infrage, weil dort das Kurhotel umgebaut wurde. Wo wurden Sie fündig, wo wurde gedreht?
Markus Imboden: Hotel und Restaurant befinden sich in Verbania am Lago Maggiore, das Rustico sich in der Umgebung von Locarno.
Überhaupt, die geografischen Vorgaben im Roman stimmen nicht. Von Cademario kann man kaum nach Agra TI schauen.
Markus Imboden: Ich hätte gern in Cademario gedreht, aber es ging nicht. Wir haben lange nach einem geeigneten Drehplatz gesucht, Verbania war ideal. Es ist am See, nicht am Hang.
Gab’s eine Zusammenarbeit mit dem Autor Markus Werner?
Markus Imboden: Nein, wir hatten Kontakt – mehr nicht. Er hat das Drehbuch gelesen und Tipps gegeben.
Was folgt nun?
Markus Imboden: Ich habe ein nächstes Projekt. Das heisst «H», eine Romanverfilmung. Der Autor Rolf Dobelli aus Luzern ist bekannt geworden durch sein Buch «Die Kunst des klaren Denkens». Wir sind bei der Finanzierung und es wird ein teures Kinoprojekt. Es beginnt in Zürich und geht um die ganze Welt. Aber das kann noch ein, zwei Jahre dauern..
Und Sie sind dabei – als Fee oder Engel?
Martina Gedeck: Nee, als Schauspielerin.
«Jean-Stéphane Bron: Ich habe versucht zu verstehen»
Er ist ein Mann, der polarisiert: Christoph Blocher wird bewundert oder angefeindet. Der Erfolgsunternehmer, Polit- und Volkstribun ist eine markante Schweizer Persönlichkeit und verkörpert ein Kapitel Schweizer Politgeschichte. Jean-Stéphane Bron ist ihm mit der Kamera auf den Leib gerückt: «L’expérience Blocher» heisst sein Dokumentarfilm.
Am Filmfestival Locarno erregte der Film bereits breite Aufmerksamkeit. Ein Sturm im Wasserglas wurde um das Filmporträt «L’Expérience Blocher» von Jean-Stéphane Bron entfacht. Der hatte es doch tatsächlich gewagt, mit materieller Bundesunterstützung dem Macchiavelli der SVP, Alt-Bundesrat Christoph Blocher, ein Porträt zu widmen. O je – darf man Filmsubventionsgelder (260 000 Franken vom Bund) für eine politisch umstrittene Persönlichkeit ver(sch)wenden? Man darf und sollte es wieder tun. Nein, er hat den Polit-Machtmenschen und gewieften Unternehmer nicht vom Sockel gestürzt, er hat auch keinen Glorienkranz gewunden, er versuchte, hinter die Maske des SVP- Strategen und Volkstribuns zu schauen. Bron selber interpretiert das Subjekt seines Films, ordnete Blocher ein, füllt die Lücken mit eigenen Einschätzungen.
Das Plakat und Titelbild des Flyers zu Ihrem Film machte mich stutzig: Blocher wirkt wie in Trance, wie ein Totenbild. Ist das so?
Jean-Stéphane Bron: Ja, das ist beabsichtigt. Ich zitiere den Maler Lucian Freud, Enkel des Psychoanalytikers Sigmund Freund. Das ist ein Stillleben, Blocher wusste von diesem Plakat.
Sie setzen die Reihe Ihrer politischen Filme mit dem «Blocher Experiment» fort. Was reizte Sie am Populisten und Parteiführer Blocher?
Seine Geschichte sagt viel über die Epoche. Ich habe mich gefragt: Wie funktioniert er, wieso identifizieren sich Menschen so stark mit ihm?
Alt-Bundesrat Blocher hat viele Etiketten als Volkstribun, Parteiführer, Ikone, als Symbol für Macht und Erfolg. Was war Blocher für Sie, bevor Sie mit ihm gefilmt haben?
Für mich war er ein historischer Führer der Union Démocratique du Centre, so wie die SVP auf Französische heisst. Den deutschen Namen Schweizerische Volkspartei finde ich übrigens viel passender und prägnanter. Ich kannte vorher nur das äussere, das mediale Bild, ich wollte wie ein Maler seine innere Landschaft zeichnen.
Wie sah Ihre Strategie aus?
Ich wollte ihm nicht das Wort übergeben, es ihm überlassen, wollte nicht, dass er zum Leader seiner eigenen Geschichte wurde und sie erzählt.
Welche Position haben Sie als Filmer eingenommen, waren Sie Beobachter, Reflektor, Analyst, Kommentator?
Ein bisschen von allem. Ich habe beobachtet und habe versucht, die Figur zu rekonstruieren.
Zentrale Begegnungsstätte ist das Auto. Die Autofahrten ziehen sich wie ein roter Faden durch den Film. Wie ging das vonstatten?
Es gab den Chauffeur, Herrn Blocher, seine Frau und mich. Die Kamera war installiert, sie beobachtete. Eine Metapher des Schauens und Schützen. Mit der Kamera suche ich die richtige Distanz zu Blocher. Das Auto verkörpert den mentalen Raum. Der Kommentar, mein Kommentar findet im Auto statt.
Was waren Ihre Bedingungen und seine?
Es gab zwei Sachen, die ich ausklammern musste: das Familienleben, das ich auch gar nicht dokumentieren wollte, und den Bereich der Wirtschaft, die EMS-Werke und Geschäfte, wohin ich nicht gehen konnte. Ich wollte seine Intimität ausleuchten, das entspricht aber nicht dem Privaten, wollte seine Sicht, seine Visionen einnehmen und einfangen. Man könnte sagen: Das ist ein Mann, der vor seinem Tod sein Leben anschaut.
Es gibt doch Szenen, die ich als privat taxiere, beispielsweise wenn Blocher in seinem Pool über dem Zürichsee schwimmt, wenn er schläft oder allein seine Anker-Bilder anschaut…
Für mich sind das keine Privatbilder, sondern inszenierte Bilder. Die Szene mit dem Pool versinnbildlicht für mich die Integration dieses Mannes mit der Landschaft. Christoph Blocher geht förmlich in der Landschaft auf.
Silvia Blocher begleitet ihren Mann ständig, fungiert aber nur als schweigende Begleiterin.
Sie ist eine Figur, die quasi für den Film konstruiert wurde – mit Schuss und Gegenschuss. Sie soll auch diese mysteriöse Rolle spielen. Er fragt sie oft während der Autofahrten und sie antwortet meistens nicht direkt, das haben wir bewusst drin behalten, auch um Zweifel zu evozieren. Im Leben ist sie diejenige, die ihn anschaut – und das ist wichtig für ihn. Sie gibt ihm Sicherheit.
Sie stützen sich in Ihrem Film auf drei Elemente: die Gespräche mit Blocher, eigene Dokumentaraufnahmen von Anlässen und privaten Momenten sowie Archivbildern. Ihre Perspektive und Haltung bringen Sie als Kommentator dezent, aber hörbar ein. Wie hat sich diese Form entwickelt?
Der Kommentar ist am Schreib- und Schneidetisch entstanden. Aber ich wusste von Anfang an, dass ich einen persönlichen Kommentar beifügen würde, den ich auch selber spreche. Die Autofahrten bildeten die Basis, die Grundierung des Films.
Sie wollten die Persönlichkeit Blocher in einen grösseren politischen und gesellschaftlichen Zusammenhang stellen und ein Zeitbild zeichnen.
Das ist klar. Vielleicht ist dies das Ende der Blocher-Ära. Man trägt ihn bereits jetzt zu Grabe. Die Frage ist: Was hinterlässt er, wie gingen wir mit ihm um? Der Film blickt zurück, aber auch voraus.
Was war die grösste Herausforderung bei diesem Unterfangen, das sich von den Dreharbeiten am 1. August 2011 bis Anfang 2013 hinzog?
Vor allem der Kampf gegen die Aktualität. Dann habe ich überlegt: Was bleibt, was ist essentiell, um diese Sage, diese Legende schreiben zu können. Beim Schneiden haben wir uns tatsächlich manchmal vorgestellt, er wäre schon tot. Für einige wirkt der Film wie ein Nachruf.
Dem Politiker Blocher sind Sie sehr nahe gekommen, auch dem Menschen? Ist das Phänomen Blocher für Sie fassbarer und sympathischer geworden?
Ich kann nur sagen, was den Film betrifft, was ich konstruiert habe, was hier passiert. Im Film ist er sicher greifbar geworden, gleichzeitig aber auch ein Geist geblieben. Der Film widerspiegelt meine Erfahrung und unser kollektives Unterbewusstsein. Sicher gab es auch sympathische Momente alles andere wäre gelogen, aber darum geht es nicht.
Sie sagen im Film: «Sie sind ein Machtmensch, und ich fühle mich als Komplize». Ist dies eine Momentaufnahme, ein Stimmungseindruck oder die Quintessenz Ihrer Blocher-Filmerfahrung?
Es gab sicher Momente, wo man sich sehr nahe war, und sich die Frage nach der eigenen Position stellte. Bin ich ein Komplize, ein Kriegsreporter, wo ist mein Platz? Meine Kommentare sind ehrlich und sollen meine Gefühle wiedergeben, die einem kommen, wenn man es mit einem politischen Gegner zu tun hat. Es gab auch diese Spannung zwischen einem Vertrauensverhältnis, das man aufgebaut hat, und einem Wahlplakat der SVP, dem man begegnet. Ich habe versucht zu verstehen, aber nicht zu entschuldigen.
Jean Stéphane Bron
1969 in Lausanne geboren
Filme: «Mais im Bundeshaus» (2003, Schweizer Filmpreis)
«Cleveland versus Wall Street» (2010, Schweizer Filmpreis 2011)
Gründungsmitglied der Produktionsfirma Bande à part Films,
mit Ursula Meier, Fréderic Mermoud, Lionel Baier.
Cadrage 2013
Zürcher Filmpreise 2013: Aura von Erfolg
rbr. Neuer Schauplatz – altes Prozedere. Im schönen Inventsaal Aura, in der ehemaligen Zürcher Börse, Nähe Paradeplatz, wurden die erfolgreichsten Schweizer Filme und Zürcher Filmwerke ausgezeichnet. Die Surrounding Videoinstallation von Ivan Engler und der akustische Rahmen des Tobias Preisig Quartett gaben dem Cadrage-Anlass eine musische Aura. Gesichtet wurden Corine Mauch, Zürcher Stadt- und Stiftungspräsidentin, Michael Künzle, Winterthurer Stadtpräsident, und Moderator Daniel Waser, Geschäftsführer der Zürcher Filmstiftung sowie viele Schweizer Filmschaffende.
Es ging nicht nur um Auszeichnungen und Belobigungen, sondern um harte Franken. Die erfolgreichsten Schweizer Filme erhielten ihren verdienten Erfolgslohn (Succès Zürich), also Erfolgsprämien, die in die Entwicklung neuer Projekte gesteckt werden müssen.
Das sind die Kurzfilme «Un Mundo para Raùl» (20 000 Franken), «The Kiosk» (15 000) und «Zimmer 606» (10 000), die Dokumentarfilme «More Than Honey» von Markus Imhoof, (120 000 Franken für Produktion und Regie), «Die Kinder vom Napf» von Alice Schmid (90 000 Franken für Produktion und Regie) und «Die Wiesenberger» von Bernard Wieser und Martin Schmitt (60 000 Franken);
die Spielfilme «Sister – L’enfant d’en haut» von Ursula Meier (250 000 Franken für Produktion, Regie, Drehbuch), für «Eine wen ig – dr Dällebach Kari» von Xavier Koller (180 000 Franken für Produktion, Regie, Drehbuch).
Der Winterthurer Kurzfilmpreis 2013 ging an Benny Jabergs aberwitzige russische Sauftour «The Green Serpent – Of Vodka, Men and Distilled Dreams», eine «Ode an die Leidenschaft, nicht nur für Trinkwürdige, sondern für all jene, die angetrieben sind von Neugier und von einer Sehnsucht nach Ekstase», so die Jury.
Der Zürcher Filmpreis ging an den intim-beherzten Mutter-Sohn-Spielfilm «Rosie» von Marcel Gisler (20000 Franken), an das wunderbare, leider im Kino zu wenig beachtete Künstlerporträt «Harry Dean Stanton: Partly Fiction» von Sophie Huber (30 000 Franken), an das innige, stimmige Elternporträt «Vaters Garten – Die Liebe meiner Eltern» von Peter Liechti (50 000 Franken).
Filmtipps
«Ender’s Game»
Ein Spiel mündet in der Realität. Der zwölfjährige Ender, hochbegabt und eigensinnig, wird zum Hoffnungsträger der Welt, meint Rekrutieroberst Graff (Harrison Ford). Der Knabe wird zum Führer und Stratege ausgebildet und erkoren, um einen präventiven Vernichtungskrieg gegen Aliens (riesige Spinnen- Monster) zu führen, die vor 50 Jahren die Erde heimsuchten, In einer gigantischen Raumschule wird er zusammen mit anderen Jungen und dem Mädchen Petra (Hailee Steinfeld) auf die Aufgabe vorbereitet. Im Hintergrund zieht der vormalige Erdenretter Mazer Rackham (Ben Kingsley in Maori-Tatoos) die Fäden. – Gavin Hoods spektakuläre Kinoadaption des SF-Buchklassikers «Ender’s Game» (1985) von Orson Scott Card kann vor allem visuell überzeugen. Bemerkenswert sind auch die (Film-)Tatsachen, dass Kinder die Welt retten müssen (freilich im Aggressionsschema der Erwachsenen) und dass der junge Anführer Kommunikation dem Krieg vorzieht. Die unterschwellige Kritik an der US-Irak-Kriegsstrategie ist unverkennbar – mindestens im Film. Merke, der letzte Irak-Krieg, von den USA angezettelt, fand 2003 statt.
****°°
«The Lunchbox»
Ein Liebesfilm, der durch den Magen geht – fern von Hollywood. Schauplatz ist das Grossbüro einer Versicherungsgesellschaft in Mumbai (Bombay). Da versieht akkurat seit 35 Jahren Saajan seine Dienste. Er steht kurz vor der Pensionierung. Und da geschiehts: Eines Tages wird ihm vom Dabbawalla, einem Boten, wie alltäglich seine Lunchbox geliefert. Überraschung: Köstliches steigt ihm in die Nase, es mundet. Eigentlich ist er der falsche Adressat. Er nimmt das vorbereites Mittagessen genüsslich entgegen und beginnt mit der ihm unbekannten Köchin einen kleinen Briefverkehr. Sie heisst Ila, die eigentlich die Lunchbox für ihren Mann zubereitet und von ihm mehr als vernachlässigt wird. Sie setzt Hoffnungen auf diesen platonischen Lunchbox-Verkehr, kennt den älteren Verköster nicht – wie auch umgekehrt. Der Inder Ritesha Batra hat einen intimen Liebesfilm inszeniert – fern von Bolly- und Hollywood. Das macht Appetit – auch ohne Küsse und Sex. Wunderbar!
*****°
(Start: 14. November)
«Exit Marrakech»
Afrikanische Annäherung. Oscar-Preisträgerin Caroline Link hat’s mit Afrika (spätestens seit «Nirgendwo in Afrika», 2003). Diesmal schickt sie Vater und Sohn auf eine Marokko-Selbstfindungsreise. Internatszögling Ben (Samuel Schneider) soll in den Ferien seinem Vater Heinrich (Ulrich Tukur) nach Marrakech nachreisen, der dort anlässlich eines Festivals deutsche Theaterkultur vermittelt und inszeniert. Der besessene Theatermensch hat sich bisher wenig bis gar nicht um den nunmehr 17-Jährigen gekümmert. Und der ist sauer auf seinen Kulturvater und nimmt Reissaus. Er geht auf Entdeckungsreise, zuerst im Milieu von Marrakech, dann ins Atlasgebirge. Er folgt der Prostituierten Karima (Hafsia Herzi) in ihr Heimatdorf. Plötzlich macht sich Heinrich Sorgen und sucht seinen Teenager-Sohn. In schöner und wilder Landschaft finden sich die beiden Fremdgewordenen. Die arabische Welt bleibt schöne Kulisse, die Landschaften, besonders die Wüste, bilden eine wunderbare Kulisse und die Schauspieler (auch in Nebenrollen wie Josef Bierbichler als Schuldirektor und Marie-Lou Sellem als Alibi-Mutter) geben ihr Bestes. Doch das Drehbuch ist schwach und durchsichtig: Die Versöhnungsreise des lebenshungrigen Diabetikers Ben und des väterlichen Kulturmissionars ist vor Kitsch und Märchenhaftigkeit nicht gefeit. Zu empfehlen für Romantiker und Schöne-Welt-Filmanhänger. Das geschönte Beziehungsdrama taugt zum Selbsterfahrungstrip nur bedingt, wohl aber als Reiseprospekt.
***°°°
«La Vénus à la fourrure – Venus im Pelz»
Geschlechterkampf im Theater. Ein Film gegen den Strom. Roman Polanski verlässt sich bei seinem Zwei-Personen-Clinch auf die Suggestion der Worte und Darsteller. Der Vorsprechungsversuch der scheinbar vulgären, aufsässigen und aufdringlichen Schauspielerin Vanda (Emmanuelle Seigner) scheint hoffnungslos. Theaterregisseur Thomas (Mathieu Amalric) ist genervt und – dann geradezu elektrisiert, als Vanda in die Rolle der «Venus» schlüpft. Und die zieht den Autor und Regisseur in ihren Bann, macht ihn zum Mitspieler, Hörigen und Diener. – Nach dem Broadway-Erfolg des Stücks «Venus im Pelz» (von David Ives) hat Polanski seine Filmfassung inszeniert und in ein leer stehendes Theater verpflanzt (ursprünglich war es ein Probenraum) und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit, Spiel im Spiel. Es knistert, die Anspielungen, Andeutungen auch auf die Welt Sacher-Masochs, dem Stofflieferanten sozusagen, werden dezent durch Gestik und Bewegung der zunehmend dominierenden Vanda/Venus skizziert. Das Duell eskaliert: ein ungleicher Geschlechterkampf. Alles dreht sich um Macht und Sex und Hörigkeit. Polanski kommt dabei ohne eigentliche Sexszenen aus, lässt die Phantasie wuchern und liefert ein kammerspielartiges Kinostück der intelligenten Extraklasse.
*****°
(Start: 14. November)
«Eltern»
Eltern haben’s schwer, Kinder leicht? Theoretisch klingt das toll: Er macht den Hausmann (auf Zeit) und Daddy im Dauereinsatz, sie geht in ihrem Beruf als Anästhesistin auf. Doch wie lange? Das gut gemeinte und gedachte Familienkonzept gerät aus den Fugen, als Conrad (Charly Hübner) wieder seiner Theaterleidenschaft frönen möchte und Christine (Christiane Paul) zurückstecken soll – beruflich. Denn die Töchter Emma (Emilia Pieske) und Käthe (Paraschiva Dragus) wurden bisher väterlich versorgt, wurden anspruchsvoll behütet und rebellieren, als die Eltern sich an der neuen Situation reiben und verkrachen. Es droht das Chaos, auch ein gefühlsmässiges. Kann man die Ansprüche und Gefahren eines familiären «Bermuda- Dreiecks» lösen, umschiffen, bewältigen, ohne dass einer Schiffbruch erleidet? Regisseur Robert Thalheim hat diese Familienkomödie mit realsozialem Hintergrund mit Schwung, Frische und gebotenem Ernst auf Kurs gebracht. Ein wunderbar unprätentiöser Familienclinch mit Aussicht auf Glücksmomente.
****°°
(Start: 14. November)
«Blue Jasmine»
Lebenslüge eines Luxus-Luders. Woody Allen is back. Nach seinen eher touristisch seichten Liebelei-Ausflügen nach Paris «Midnight in Paris» (2011) und Rom «To Rome with Love» (2012) hat er zu alter neuer Form und Bissigkeit zurückgefunden. – Das Luxusweibchen Jasmine (Cate Blanchett) erlebt in New York Schiffbruch auf der ganzen Linie. Ihr Ehemann Hal (Alec Baldwin), Spekulant und Betrüger, landet im Knast. Die High-Society-Diva muss notgedrungen bei ihrer Schwester Ginger (Sally Hawkins) in San Francisco unterschlüpfen. Die verwöhnte Jasmine macht dem naiv-gutmütigen Schwesternherz als auch ihrem potenziellen Lebenspartner Chili (Bobby Cannaval) das Leben madig. Die gestrandete Besserwisserin Jasmine zeigt sich in jeder Hinsicht uneinsichtig, lebt ihre Lebenslüge weiter und ist ärmer denn je. Sie manövriert sich selber ins Abseits, in den Abgrund – verbohrt, uneinsichtig und unfähig, der eigenen Wahrheit ins Auge zu schauen. Jasmine ist kein Mensch, mit dem man Mitleid hat – so schonungslos gut verkörpert sie Cate Blanchett. Woody Allens neuester Sozial-Beziehungsstreich lässt sich auch als Spiegelbild amerikanischer Verhältnisse und Verblendung lesen: Jasmine lebt auf Kosten anderer, glaubt sich hochfahrend überlegen, fällt fürchterlich auf die Schnauze, wird Opfer ihrer Uneinsichtigkeit und Lebenslüge. Ein spätes Meisterstück des Beziehungsanalysten Allen, der eine verlogene fadenscheinige US-Gesellschaft demaskiert.
*****°
(Start: 21. November)
«Captain Philipps»
Piratenterror vor Somalia. Die Gewässer vor Somalia sind gefährlich. Piraten kapern Schiffe und erpressen Lösegeld. Ein derartiger Vorfall von 2009 diente Filmer Paul Greengrass als Basis für seinen Actionfilm auf hoher See – nach einer wahren Begebenheit. Das US-Containerschiff Maersk Alabama ist im Indischen Ozean unterwegs und wird am Horn von Afrika attackiert. Zuerst gelingt es Captain Richard Phillips (Tom Hanks), die somalischen Piraten durch geschickte Schiffsmanöver abzuschlagen, bis es einer Handvoll bewaffneter Räuber doch gelingt, den Frachter zu entern. Der Captain hat den Grossteil seiner Besatzung in den Maschinenraum beordert, wo sich rund 20 Mann versteckt halten. Die Piraten unter Führung von Muse (Barkhad Abdi) setzen Phillips und seinen ersten Offizier Shane (Michael Chernus) unter gewaltigen Druck, wollen Geld, geben sich aber nicht mit den 30 000 US-Dollar aus dem Tresor nicht zufrieden. Der Captain versucht, den Konflikt ohne Gewalt zu lösen. Doch die Geiselnahme eskaliert. US-Streitkräfte rücken an. – Bei diesem schonungslosen Thriller über zwei Stunden ist das Ende zwar absehbar, aber gleichwohl atemberaubend. Die kidnappenden Gesellen, vage als Fischer in Not skizziert, werden bis auf eine Ausnahme (der jüngste Pirat) als finstere Gangster gekennzeichnet, die für einen Mafiaclan auf Raubzug sind. Solche kriegerischen Konflikte in Thrillermanier aufzubereiten, sind die Amerikaner Meister und nutzen diese Filmgelegenheit, um der amerikanischen Seele, von all den alltäglich Niederlagen national und global, von Gewaltakten gebeutelt, Linderung und Triumph zu verschaffen. Die Militärmaschinerie funktioniert, und der Captain ist der Held, wenn auch nicht strahlend, aber doch gewieft und menschlich. Tom Hanks überzeugt dabei als Familienmensch und harter Kerl auf und unter Wasser.
****°°
(Start: 14. November)
«Achtung. Fertig, WK!»
Klamauk zwischen Kaserne, Küche und Knatsch. Die Fortsetzung liess zehn Jahre auf sich warten. Marco Rima, inzwischen Kommandant Reiker, und Martin Raold (Wachtmeister Weiss) sind wieder dabei. Ein Foto an Melanie Winiger («Achtung, fertig, Charlie!») erinnert an vergangene Flirts und Ferkeleien. Diesmal muss Alex (Matthias Britschgi) in den WK einrücken, um seiner schwangeren Liebsten, Anna (Liliane Amuat – eher nervig aufdringlich als überzeugend), ein Heim zu sichern. Und das bietet ausgerechnet Annas Vater an, der erwähnte Kommandant. Doch der stellt die Bedingung, dass Pazifist Alex in den WK einrücken muss. Und so nehmen die seichten Scherzchen und deftigen WK-Spässchen ihren Lauf – backen, bumsen, ballern inbegriffen. Oliver Rihs inszenierte die Militärklamotte, in der Frauen (auch ohne Melanie W.) sich abmühen, Letztlich gewinnen Vater- und Vaterlandsfreuden Überhand. Gut so für die Volksseele oder! Das neu initiierte Film-Manöver sieht zwar auch einen Besuch im Freudenhaus vor, versteht sich aber mehr als freudiges Ereignis – fürs Militär, für Liebende, verständige Männer und – schlichte Kinogänger. Ein Vergnügen ohne Folgen – je nach Sicht und Laune.
**°°°°

