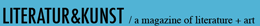Buchcover «Maison de la Chine», Park Books, 2025

Südost-Ansicht Fotos © Tian Fangfang

Gebäde-Ansicht von Norden

Blick von der Gartendachterrasse auf den Eiffelturm
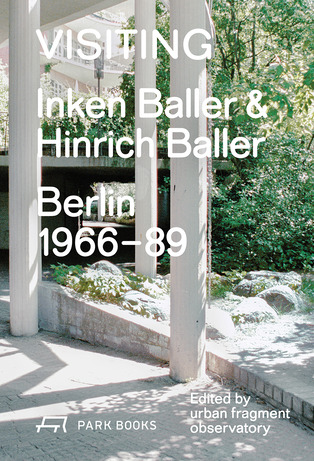
Buchcover VISITING, Park Books, 2025

Wohnhaus, Lietzenburger Strasse 86, Berlin

Wohnhäuser mit bepflanzter Terrasse, Fränkelufer 26-44, Berlin
«Maison de la Chine, Paris – The convergance of two cultures»
The Maison de la Chine in the Cité internationale Uiversitaire de Paris (CIUP) shows the convergance of two cultures in form and concept. Designed by Beijing-based Atelier Feichang Jianzhu (Atelier FCJZ) in collaboration with the French architecture firm Coldefy, the building continues the tradition of national pavillons within the CIUP.
The Maison de la Chine – A First and a Last
The Maison de la Chine is both a first and a last: it is the first institutional building by a contemporary Chinese architecture practice completed overseas, and it is the latest (and possibly last) addition to the collection of national “houses” on the campus of the Cité international universitaire at the southern edge of Paris designed to accommodate international students. China’s belated yet assertive entry into this community of nations echoes the bold arrival of contemporary Chinese architecture on a global stage over the past two decades, which likewise unfolded in a belated but all the more fulminant chain of events. Atelier FCJZ and its principals Yung Ho Chang and Lijia Lu played a key part in this larger process, and their Maison de la Chine signifies both its culmination and its logical conclusion.
The Cité international universitaire was founded in the aftermath of World War I by a group of French intellectuals with the explicit aim of fostering peace, through cultural understanding, among primarily European nations. In spirit very much related to the League of Nations, in its initial decades the Cité represented the colonial world order of its time, which at first left many nations and peoples unrepresented. While an early unexpected project for a house for Chinese students and culture dates back to the late 1920s, it took more than eighty years for such a vision to be finally realized – and for China to enterinto this “permanent exposition” of architecture. The Cité’s camus was from the beginning conceived as something of an architectural fairground, not unlike perhaps the Giardini of the Venice Biennale, where a few select nations were represented by their own pavillons, many of them expressing the cultural values and traditions of their originating country through architectural form and ornament.
Die 2023 eröffnete Maison de la Chine in der Cité internationale universitaire de Paris: die Annäherung zweier Kulturen in Form und Konzept
Die Maison de la Chine wurde 2023 als Teil der 1925 gegründeten Studentensiedlung Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) eröffnet. Der vom in Beijing beheimateten Atelier Feichang Jianzhu (Atelier FCJZ) entworfene und in Zusammenarbeit mit dem französischen Büro Coldefy realisierte Bau führt die lange Tradition der Länderpavillons in der CIUP fort. Der Entwurf trägt die DNA traditioneller chinesischer Architektur, Atelier FCJZ steht jedoch auch klar zu seiner Inspiration durch Le Corbusier.
Diese Baumonografie präsentiert das fertige Gebäude und dokumentiert ausführlich den Entwurfsprozess für das Studentenhaus mit Skizzen, Zeichnungen, Plänen und Fotografien. Der Schweizer Architekturhistoriker und Kurator Martino Stierli ordnet das Gebäude in die Entwicklung zeitgenössischer chinesischer Architektur ein. Yung Ho Chang, Gründungspartner von Atelier FCJZ, und Yishi Cheng, einer der Architekten des Projektteams, erörtern im Gespräch konzeptionelle und technische Aspekte des Baus. Ein informativer Essay des französischen Architekturkritikers Ariel Genadt setzt das Projekt in Beziehung zur aussergewöhnlichen Geschichte des Ortes und der Kultur, innerhalb derer es entstanden ist.
Maison de la Chine
A Building by Atelier FCJZ
Herausgegeben von Yung Ho Chang
Park Books, 2025
Broschiert, 121 S., 121 farbige und 28 s/w-Abb.
Englisch, Frazösisch
20.5 x 23.5 cm, CHF 29
ISBN 978-3-03860-364-1
«VISITING – Bauten in Berlin 1966-89»
Zu Besuch in den wegweisenden Wohnbauten, die Inken & Hinrich Baller zwischen 1966 und 1989 in Berlin realisiert haben: Vorbilder für qualitativ hochstehenden und bezahlbaren Wohnraum und die Schaffung spannender Stadträume.
Zwischen 1966 und 1989 haben Inken (geboren 1942) und Hinrich Baller (1936–2025) gemeinsam 25 Bauten in West-Berlin und ein Wohnhaus in der Schweiz geplant und realisiert. Obwohl die meisten ihrer Gebäude im engen Rahmen des sozialen Wohnungsbaus entstanden sind, bieten sie immer mehr als den Standard: Filigranität, Helligkeit, grosse Balkone, Terrassen und Gärten, gute Belichtung dank gläserner Innenwände, grosszügige Wohnungsgrundrisse, komplexe Raumzusammenhänge über mehrere Etagen. Mit ihren unkonventionellen Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden schufen die Ballers Situationen, die nach wie vor als Vorbilder für qualitativen und bezahlbaren Wohnraum und spannende Stadträume stehen.
Diese umfassende englischsprachige Werkübersicht, erstmals 2022 als Broschur im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König erschienen und schnell wieder vergriffen, erscheint nun in einer korrigierten Neuausgabe. Sie bietet eine ausführliche fotografische Dokumentation des Ist-Zustands der Gebäude im Gebrauch sowie die vollständigen und aufgearbeiteten Original-pläne. Ergänzt werden diese durch Dokumente wie Verkaufsbroschüren, Baustellenfotos und Luftbilder. Aufsätze und Gespräche mit Inken und Hinrich Baller sowie mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Häuser runden die inhaltliche Reflexion ab.
Die Bauten von Inken und Hinrich Baller erfahren gerade eine Neubewertung. Ihr expressiver Architekturstil polarisiert, doch wer einmal in einer ihrer Wohnungen lebt, will meist nie wieder ausziehen. In ihrer gemeinsamen Schaffensphase von 1966 bis 1969 haben Inken und Hinrich Baller unkonventionelle Häuser gebaut, die bis heute das (West-)Berliner Stadtbild prägen. Besonders ihr Wohnungsbau – filigran, durchlässig und mit ungewöhnlichen Grundrisslösungen – gilt heute als wegweisend: die zum Wohnraum offenen Küchen etwa oder die Verschränkung von Innen- und einem grünen Aussenraum. Nun ist Hinrich Baller mit 89 Jahren gestorben.
VISITING
Inken Baller & Hinrich Baller, Berlin 1966–89
Herausgegeben von Urban Fragment Observatory
Park Books, 2025
Geb., 544 S., 147 farbige und 322 s/w-Abb.
17 x 24 cm, CHF 49