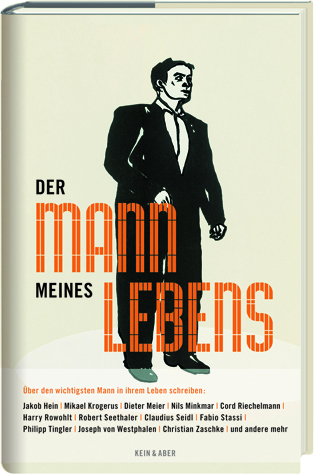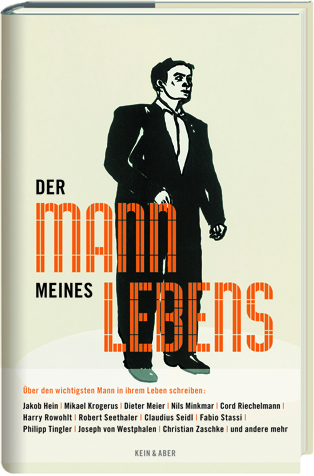
«AUF DER SUCHE NACH DEM SUPERMANN»
Von Joseph von Westphalen
Es gibt Menschen, die man nie vergisst. Menschen, die uns etwas gelehrt haben, uns geprägt haben, die uns als gutes oder schlechtes Beispiel vorangegangen sind, ohne die wir nicht wären, die wir sind. Im Leben eines Mannes ist dies nicht selten ein anderer Mann. Was kann der Mann dem Mann bedeuten? Bekannte Männer schreiben über den bedeutendsten Mann in ihrem Leben – wofür sie ihn bewundern und ablehnen.
1.
Zu den unausstehlichsten Bemerkungen der Arbeitswelt
gehört der Satz »Geht nicht gibts nicht«, mit dem ungeduldige Chefs in Fernsehfilmen und leider auch in Wirklichkeit längst nach Feierabend ihren schlotternden Mitarbeitern über den Mund fahren. Der Angestellte will zwar Karriere machen oder wenigstens eine Gehaltserhöhung, aber er will seine Ehe nicht aufs Spiel setzen. Diesmal hat er versprochen, um sechs Uhr zu Hause zu sein, und es ist schon wieder halb neun. Jetzt in Dutzenden von Aktenordnern nach einem Vertrag zu suchen, mit dem man bei der morgigen Verhandlung etwas gegen irgendeinen Konkurrenten in der Hand hat oder auch nicht, würde Stunden dauern. Er könnte gleich im Büro übernachten und bräuchte sich dann die Vorwürfe seiner Frau nicht anzuhören: »Dein Chef ist dir wichtiger als ich, du autoritätsfixierte Männermemme!«
»Aber«, fängt er tapfer an und will den Chef darauf hinweisen, dass es menschenunmöglich ist und nebenbei nicht gerade menschenwürdig, im Kellerarchiv in so kurzer Zeit so viele Ordner durchzusehen, dazu bräuchte ein Team von mehreren Leuten mehrere Tage. Doch ehe er das gesagt hat, kommt ebenjener Satz, den der Chef vielleicht einmal in einem Seminar für Führungskräfte von einem zwielichtigen Motivationstrainer als Geheimwaffe empfohlen bekam. Wenn etwas klemmt und in der Belegschaft Überstundenunlust erkennbar wird, einfach »Geht nicht gibts nicht!« bellen und zur Tür hinausgehen, um Diskussionen zu vermeiden.
Es wird Zeit, den zur Höchstleistung aufgeforderten und innerlich zornig zitternden Lohnsklaven in seiner Not allein zu lassen mit seinen wollüstigen Mordvorstellungen, wie er den für seine Laufbahn leider so wichtigen Chef am qualvollsten um die Ecke bringen oder wenigstens zu einer Abbitte veranlassen könnte. Er hat die Chance, sich mit einem aufmüpfigen »Gehts noch?« zu wehren oder das unzumutbare Kläffen des Chefs mit einem langen skeptischen Blick infrage zu stellen. Oder aber er kapituliert frustriert oder einsichtig, begibt sich ins Kellerarchiv, macht sich an die Wühlarbeit, wird um zwei Uhr in der Nacht fündig, tippt halb tot vor Müdigkeit ein Thesenpapier, in dem er für den begriffsstutzigen Chef die sich nun ergebenden neuen Argumente zusammenfasst, verlässt dann doch das Büro, schleicht sich schließlich früh um halb fünf ins Ehebett und bekommt von seiner Frau einen anderen berühmten Satz zu hören: »Ich hasse dich!«
»Geht nicht gibts nicht« – mithilfe dieser vier oder fünf Wörter werden in den ehrgeizigen Industriegesellschaften Arbeitsplätze erhalten oder vernichtet, wird das Wachstum vermehrt und die Welt versaut und weitergetrieben – an den Rand des Abgrunds, wie man als kritischer Mensch korrekt mahnend hinzuzufügen hat. Wobei man ehrlicherweise erwähnen sollte, dass der Weg zurück in die Vernunft auch einige Kraft kosten würde und Forschungsinstitute oder Betriebe, die sich erneuerbaren Energien oder schnuckeligen polkappenschmelzeverhindernden
Elektromobilen verschrieben haben, vermutlich auch nicht ohne unzureichend bezahlte 18-Stunden-Jobs und das immer wieder herausgebrüllte oder hervorgezischte Durchhaltemotto auskommen. Selbst Bewährungshelfer versuchen mit dieser Parole ihre kriminellen und drogensüchtigen Schäfchen vor dem Rückfall zu bewahren und auf dem schweren Gang zurück in die saubere Legalität anzuhalten, am besten rhythmisch rappend, dann klingen die aufmunternden Wörter nicht so soldatisch:
Hey, Alter / Nachtfalter / führ mich nicht / hinters Licht / Nix pennen / jetzt rennen / Geht nicht / gibts nicht! Gäbe es mehr Frauen in Führungspositionen, das darf nicht unerwähnt bleiben, würden mehr Frauen mit diesem Zuruf ihre Mägde und Knechte schikanieren. Der Vorgesetzte, der das Unmögliche verlangt, ist ein Topos in vielen Krimis, in denen der meist als unfähig und politisch korrupt dargestellte Behördenchef von oben Druck bekommt, sofort an den Ermittler weitergibt und von diesem mal schulterzuckend, mal mit einem cholerischen Anfall verlangt, er habe binnen 24 Stunden den Mordfall aufzuklären oder – auch das kann sein – er müsse die Ermittlungen sofort einstellen, weil – jetzt flüsternd – der Sohn des Ministers in den Fall verwickelt sei. Im aufgeklärten europäischen Krimi ist der Chef meist ein Trottel.
Der bewunderte Chef ist die obrigkeitshörige amerikanische Variante: Ein junger Lackaffe (Typ Tom Cruise) hat ein Superexamen gemacht, wird nun von einer Riesenkanzlei abgeworben, mit europäisch noblen Firmenwagen ausgestattet und vom allerheiligsten Boss (Typ Al Pacino) persönlich unter die Fittiche genommen. In diesen Filmen sagt kein gemeiner Chef »Geht nicht gibts nicht«. In diesen Filmen kennt der junge, in einer Eliteuniversität glatt gebügelte Angestellte nichts Schöneres, als Tag und Nacht für den neuen Chef zu arbeiten und ihm seine Ergebnisse wie ein abgerichteter Hund freudig zu apportieren. Das zufriedene Lächeln des Chefs beim kurzen Blick auf eine in drei Tagen und Nächten erstellte 500-Seiten-Fleißarbeit meint ohne Worte: »Ich habe mich in Ihnen nicht getäuscht«. Das ist Lohn genug für alle Mühe. Der Vorgesetzte ist hier zum Lehrmeister geworden, zum Mann des Lebens, zur zunächst bewunderten Lichtgestalt, die – das ahnt man – bald ihre dunklen Seiten zeigen wird.
Schwer zu ertragen, die leuchtenden Augen des jungen Strebers. Die väterliche Zuneigung des unendlich reichen und mächtigen Staranwalts ist nicht weniger widerlich. Es ist, streng genommen – jetzt muss ich bitte mal kurz unkorrekt werden – der Beginn des Faschismus. Die strahlende Führerfigur wird angehimmelt und beugt sich herunter zum eifrigen Bewunderer, wie der eklige Hitler zu seinem ekligen Hitlerjungen. Nazihaft ist das und pädophil. Eine inzestuöse Vater-Sohn-Beziehung. Auch zwischen Mafiachefs und ihren potenziellen Nachfolgern gibt es solch innig verschwiemelten Adoptionsinzest, ehe
der hoffnungsvolle künftige Clanchef vom bösen Onkel aus dem verfeindeten Familienzweig endlich mit einigen Maschinenpistolensalven niedergestreckt wird. Wann immer ein Mann des Lebens auf der Bildfläche erscheint, ist Vorsicht geboten, zumindest im Hollywoodfilm. Wenn der Bewunderte sich später als moralische Sau entpuppt, gerät der Bewunderer in einen Konflikt, was den Film aber nicht rettet. Denn das Verlieren der Hochachtung ist ein ebenso penetranter Vorgang wie das Entgegenbringen von Hochachtung. Hochachtung unter Männern ist generell suspekt.
Mir als Zuschauer ist der ruppige, gemeine, achtlose, undankbare, boshafte und eindeutig blöde und von Anfang an verachtenswerte Chef im billigen Mobbing- Drama oder Tatortdes spießigen deutschen Fernsehens noch lieber als diese mafiotisch überhöhten Shakespeare-Figuren im amerikanischen Film. Ich mag auch Shakespeare-Stücke nicht, trotz ihrer flotten Sprache: Dieses ganze Herumschwänzeln um irgendwelche erbärmlichen Machthaber, die vom Autor und seinen ergebenen Regisseuren als tragisch gebrochene Figuren dargestellt werden, ist eine einzige Verblendung. Wenn stumpfsinnige Killer mit schönen Worten und einer raffinierten Psychologie ausgestattet werden, wie es nach der Wiederentdeckung Shakespeares seit nunmehr über zweihundert Jahren vorgeführt wird, soll uns damit eingeredet werden, dass der Mensch eben so sei: so machtbesessen, so intrigant, so eifersüchtig. Ja, mag sein, Menschen sind so. Aber nicht alle und nicht die interessanten. Jeder verzweifelte Kleinbürger bei Strindberg oder Ibsen mit ein bisschen Dreck am Stecken, jeder sich langweilende Versager bei Tschechow ist rührender und interessanter als die Könige
Shakespeares mit ihrem primitiven Blutrausch und den immer gleichen entnervenden Rachegelüsten. In Shakespeare- Stücken wimmelt es von Männern des Lebens, das macht sie so penetrant. Freundliche Zufälle haben mich zu einem sogenannten freien Schriftsteller werden lassen. Den Terror inkompetente und größenwahnsinniger Chefs kenne ich nur von der Leinwand und vom Bildschirm. Freunde, die in Mühlen stecken, Krankenhausärzte, Lehrer, Professoren, Anwälte in großen Kanzleien und verbeamtete Architekten, verschweigen ihre Demütigungen am Arbeitsplatz und beneiden mich um meine Freiheit (so lange, bis ich sie über die Höhe meiner Alterseinkünfte informiere) – selbst der Typ am Bankschalter, der meinen Kontostand kennt, versucht mich mit dem Hinweis zu trösten, dass ich wenigstens mein eigener Herr sei. Das ist nicht nur beneidenswert. Die Redewendung von der Überwindung des inneren Schweinehunds, die so gern gebraucht wird, wenn es darum geht, einen Berg zu erklimmen oder einen Marathonlauf durchzustehen, ist falsch. Man überwindet diesen Bastard ja nicht, man gehorcht ihm. Wenn kein schweinischer Chef Druck macht, muss man es selbst tun. Man ist also nicht sein eigener feiner Herr, sondern sein eigener boshafter Chef und sein eigenes folgsames Schaf. Wenn keiner da ist, der einen mit dem dummdreisten »Geht nicht gibts nicht«-Spruch kommt, muss man das selbst tun. Das innere Chefschwein befiehlt, und man muss folgen, wenn einem sein Leben lieb ist. Man ist, um allmählich in die Nähe des Themas zu rudern, sein eigener Mann des Lebens. Man kann sich aber nicht hassen und lieben dafür, weil Selbsthass und Narzissmus laienpsychologisch zu albern und zu durchgenudelt sind. Zu sich selbst bewundernd aufblicken – das sollte man genauso vermeiden wie das Herabsehen auf sich selbst.
2.
Die Frage, wen er sich als Mann seines Lebens vorstellen könnte, hat für einen nichtschwulen Mann einen reizvollen Gesellschaftsspielcharakter. Als sie mir gestellt wurde, fiel mir auf Anhieb niemand ein. Da gibt es keinen, dachte ich, dann aber kam die Stimme meines inneren Chefs und rief mich zur Disziplin: »Gibts nicht gibts nicht!« Da müsste mir schon einer einfallen, wenn ich in den Verliesen des Gedächtnisses danach suchen würde; und wenn es keinen gäbe, würde ich einen erfinden. Es gibt genügend Musiker und Autoren, die mein Leben begleiten. Manchen von ihnen könnte ich mühelos zum Mann meines Lebens emporschreiben, dachte ich.
Obwohl sich meine Bewunderung genaugenommen dann doch in Grenzen hält und es mir bei aller Liebe zu dem einen oder anderen Lied von Bob Dylan oder John Lennon entschieden zu weit ginge, so einen bekifften Künstler den Mann meines Lebens zu nennen. Zumal einem ja die Songs etwas bedeuten, nicht die Sänger und Songwriter. Wie einem ja auch die Bücher wichtiger sind als ihre Autoren, die oft weniger klug und sympathisch sind. Gottfried Benn zum Beispiel. Ich würde nie auf die Idee kommen, die alte Kröte als Mann meines Lebens zu bezeichnen, nur weil ein paar Sätze dieses Autors mich eine Weile begleiteten und meine Sozialisation mitbestimmten. »Sie bat den Kellner um eine Karte, so hatte die Landschaft sie berührt«, schreibt er über eine Ansichtskarte seiner Mutter aus Jena, und genauer kann man nicht beobachten, dezenter kann man nicht liebevoll sein. Von ein paar langbeinigen Beauties heißt es: »Über ihre Hingabe kann man sich gar nicht erlauben nachzudenken.« Lapidarer, unverträumter kann man den Traum von der Erfüllung der Lust nicht äußern.
Und klarer kann man nicht das Wesen des Weltgeists und den Gang der Weltgeschichte auf den Punkt bringen als mit einem Blick ins Schulgeschichtsbuch. Im Jahr 1805 kommt nach Gottfried Benns Zählung vor: »einmal Seesieg, zweimal Waffenstillstand, dreimal Bündnis, zweimal Koalition, einer marschiert, einer verbündet sich, einer vereinigt seine Truppen, einer verstärkt etwas, einer rückt heran, einer nimmt ein, einer zieht sich zurück, einer erobert ein Lager, einer tritt ab, einer erhält etwas, einer eröffnet etwas glänzend, einer wird kriegsgefangen, einer entschädigt einen, einer bedroht einen, einer marschiert auf den Rhein zu … einer auf Wien, einer wird zurückgedrängt, einer wird hingerichtet, einer tötet sich – alles dies auf einer einzigen Seite, das Ganze ist zweifellos die Krankengeschichte von Irren.«
Ohne das Nennen der bekannten Namen liest sich auch die Seite des Jahres 1849 fantastisch ähnlich: »Einer wird abgesetzt … einer hält einen pomphaften Einzug, einer verabredet etwas, einige stellen gemeinsam etwas fest, einer legt etwas nieder, einer entschließt sich zu etwas, einer verhängt etwas, einer hebt wieder etwas auf, einer trennt, einer vereint … einer überschreitet etwas … überschritten wird in diesem Jahr überhaupt sehr viel – im Ganzen ergibt sich auf dieser Seite dreimal Waffenstillstand, einmal Intervention, zweimal Einverleibung, dreimal Aufstand, zweimal Abfall, zweimal Niederwerfung, dreimal Erzwingung –, man kann sich überhaupt keine Tierart vorstellen, in der so viel Unordnung und Widersinn möglich wäre, die Art wäre längst aus der Fauna ausgeschieden. «Ich zitiere diese weltgeschichtliche Universalformel hier so ausgiebig, weil sie mich mehr prägte als jeder Mann des Lebens. Dafür kann ich Benn diverse schwülstige Gedichte nachsehen. Dass er 1933 kurzzeitig auf die Nazis gesetzt hatte, macht ihn als Idol allerdings vollends untauglich, falls man ein solches benötigt. Den Erkenntniswert dieser Zeilen schmälert das nur geringfügig. Als ich sie im Alter von sechzehn oder siebzehn Jahren las, wusste ich endlich, warum mich Geschichte nicht nur anödete, sondern regelrecht abstieß. Nicht nur wegen ihrer vielen Finsterlinge. Auch den strahlenden Figuren hatte ich von klein auf nichts abgewinnen können. Die Geschichte hielt keine Gestalten für mich bereit, die sich als Männer meines Lebens eigneten. Alexander der Große, Karl der Große, Friedrich der Große, der Staufferkönig Friedrich der Zweite mit seiner angeblichen Gelehrsamkeit und seinen Falken, Hannibal mit seinen Elefanten – ich hatte keine Lust, mich mit ihren perversen Herrschaftserweiterungs-obsessionen und ihren Feldzügen zu befassen, bezeichnete all diese Eroberer in schriftlichen und mündlichen Prüfungen trotzig als Irre und bekam denkbar schlechte Noten im Fach Geschichte. Das Tollfinden von romantisch-rebellischen Aufständischen und Tyrannenmördern war ebenfalls nicht ratsam, weil diese, wenn sie nicht rechtzeitig selbst ermordet wurden, sich alsbald in peinliche Kanaillen verwandelten.
3.
Ich habe meinen Vater nicht gekannt. Er fiel vor meiner Geburt. Es gab auch keine Ersatzväter in der Nachkriegskindheit.
Nur einen Onkel gab es, dem waren allerdings seine beiden Beine abhanden gekommen. Seine Oberschenkel waren Stummel. Er rutschte mit dem Hintern auf dem Boden herum und bewegte sich mit den Armen fort, flink zwar, aber er war keine Gefahr für Kinder, keine Autorität, vor der man sich in Acht zu nehmen hatte. Einen Vater habe ich nie vermisst. Im Gegenteil. Es war nicht schlecht, keinen zu haben. Freunde mit Vätern besuchten mich und erzählten von Ohrfeigen und Kopfnüssen, die es zu Hause gab. Vielleicht ist das entspannte und angstfreie Aufwachsen ohne Vater der eine Grund, warum ich nie zu Männern aufblicken konnte? Das ist eine sehr schlichte psychologische Erklärung. Man müsste wissen, wie es anderen vaterlosen Gesellen geht. Ich habe mich nie mit Leidensgenossen unterhalten – eben weil es kein Leiden gab.
Egal, welche erzieherische Rolle die Abwesenheit eines Vaters in der Kindheit nun spielt – fest steht: Es gab in den Jahren der Schulzeit keinen Lehrer, der sich zum Bewundern geeignet hätte. Alles Gestalten, denen man skeptisch gegenübersaß. Man hatte von Emil Zatopek gehört, dem Langstreckenläufer, der »tschechischen Lokomotive «, oder von Jesse Owens, der über acht Meter weit gesprungen war. Das war bewundernswert. So wollte man laufen und springen können. Vielleicht sind diese beiden Sportler, als ich acht oder zehn war, Männer meines Lebens gewesen. In diesem Alter erschien mir auch Ritter Delorges als Held. Friedrich Schiller hat dem Phantom in seiner Ballade Der Handschuh ein Denkmal gesetzt. Bei einer Raubtierschau von Kaiser Franz wirft eine der Edelfrauen namens Kunigunde aus der Loge ihren Handschuh zwischen die fauchenden Bestien in die Arena und wendet sich spöttisch an den Ritter: »Herr Ritter, ist Eure Lieb’ so heiß, wie Ihr mir’s schwört zu jeder Stund, ei, so hebt mir den Handschuh auf.« Er begibt sich tatsächlich »in den furchtbaren Zwinger« und holt den zwischen die mordlüsternen Löwen und Tiger gefallenen Handschuh, den er dann allerdings dem frivolen Fräulein ins verliebte Gesicht wirft: »Den Dank, Dame, begehr ich nicht.« Meine Mutter hatte sich zum Geburtstag gewünscht, dass ich den Handschuh auswendig lerne und ihr vortrage. Möglicherweise wollte sie mir damit beibringen, dass man sich vor den Forderungen kecker Frauen in Acht nehmen und mit lässigem Stolz reagieren muss. Falls Ritter Delorges einmal Mann meines Lebens war, sind seine Einflüsse bald versiegt. Wozu sich für eine Ziege in Gefahr begeben? Man kann sie doch gleich verlassen. Schade eigentlich, dass es auch auf der Universität keinen Mann meines Lebens gab. So ein Professor, von dem man tatsächlich etwas lernt, der einem eine intellektuelle Basis vermittelt, von dem man ein Leben lang zehrt, dem man nacheifern und den man später vielleicht einmal übertreffen will. Nichts. Vaterlos habe ich nie das eigentlich lebenswichtige Rivalisieren und Übertrumpfenwollen gelernt. Der Doktorvater war ein ungewöhnlich schräger Vogel, aber keiner, an dessen Lippen man andächtig hängt. Heute lerne ich in zwei Nächten im Internet mehr als in all den Semestern des Studiums. Ein Verleger könnte für einen Autor der Mann des Lebens sein. Aber auch einen solchen hatte ich nicht. Ich stelle das fest, ich beklage es nicht. Ich war den Verlegern nicht treu, ich konnte es mir nicht leisten, treu zu sein, oder sie waren mir nicht treu. Es waren Lebensabschnittspartner, es war nie ein Bündnis fürs Leben. Erfreuliche Affären, an die ich gern zurückdenke, durchaus fruchtbare Affären, immerhin kamen Bücher heraus bei den Verbindungen. Nach drei, vier gemeinsamen Büchern erkaltet das Interesse jedoch, aus dem feurigen Umwerben ist eine vage Hoffnung auf den nach wie vor ausstehenden größeren Erfolg geworden, die nur so matt glimmt, dass dieser Erfolg damit kaum noch gezündet werden kann. Maulende Kritiker (und seit Internetzeiten obendrein Amazonkunden, deren unverschämten Rezensionen entschieden zu selten ein euphorischer Kunde eine andere Meinung entgegensetzt), zurückhaltende Käufer, keine Literaturpreise, von denen man sich ein neues Auto kaufen oder in die Ferien fahren und mit denen der Verlag in Anzeigen auf den Putz hauen kann – es ist keinem Verlag zu verdenken, wenn sein Interesse an einem Autor, der mehr kostet als er einbringt, nach einigen Jahren erkaltet.
Vorstellbar ist es natürlich: lebenslang verbunden, gemeinsam durch dick und dünn, im festen Glauben daran, dass irgendwann doch einmal angemessene Aufmerksamkeit und Anerkennung entsteht. Wenn einen auf dem Gang über die Hängebrücken des Kulturbetriebs ein seit Jahren vertrauter Verleger des Lebens standhaft begleitet, der einem Schecks zusteckt, aufmunternd zuspricht und das Gefühl vermittelt, es habe schon alles seinen Sinn und es werde kommen der Tag des literarischen Gerichts, dann ist das komfortabler, als wenn man ständig allein die
Kraft zum Selbstbetrug aufbringen muss, die nötig ist, um sich bei Laune zu halten und einen Roman zu Ende zu schreiben. Allerdings ist nicht einzusehen, wieso dieser kolossale Verleger ein Mann sein muss. Eigentlich wäre mir sogar eine Frau lieber, die unerschütterlich an meine Bücher glaubt und mir das mit der nötigen Trockenheit zu verstehen gibt.
4.
Auch ein Kritiker könnte für einen Autor der Mann des Lebens sein. Marcel Reich-Ranicki war sicherlich der Mann des Lebens für etliche Autoren, deren Bücher das Glück hatten, durch seine Temperamentsausbrüche zu Verkaufserfolgen zu werden. Dieses Vergnügen ist mir nicht zuteil geworden. In materieller Hinsicht höchst bedauerlich, allerdings muss ich nicht mit einer verzerrten Publikationsgeschichte leben, wo ein Buch nur deswegen so grotesk gut ging, weil es wenige Minuten lang von einem einzigen Kritiker besonders tobsüchtig gelobt oder geschmäht wurde. Wie quälend es sein kann, vom Urteil eines mächtigen Meinungsmachers abzuhängen oder sich abhängig zu fühlen, zeigt die Veröffentlichung der Tagebücher Martin Walsers: Nach Jahrzehnten hegt der Autor noch immer Groll gegen einen Verriss des Literaturpapstes.
Leider kann ich Woody Allen nicht nennen. Er hat die Chance verspielt, Mann meines Lebens zu werden. Viele seiner Filme haben mich entzückt, und folglich hat es mich besonders gefreut, wenn manche meiner Leser meinten, in meinen Büchern sei etwas Woody-Allen-haftes.
Ich konnte es nicht nachvollziehen, genoss aber das Kompliment. Anfang der 90er-Jahre tauchte ein amerikanischer Verleger auf. Sein kleiner Verlag brachte fast nur Bücher von jüdischen Autoren heraus. Er wollte meinen ersten Duckwitz-Roman in seinem Programm haben, weil er den Witz darin jüdisch fand. Da freut sich der Goi.
Der Roman wurde übersetzt, und der Verleger ließ durchblicken: Er kennt einen, der Woody Allen kennt, und der werde dafür sorgen, dass Woody Allen meinen Roman in die Hand gedrückt bekomme. Wer weiß, vielleicht werde er plötzlich Verfilmungsgelüste verspüren. Flausen. Woody Allen würde nie fremde Stoffe verfilmen.
Ob Diplomatic Pursuits den Weg in sein Bücherregal geschafft hat, ist zu bezweifeln. Trotzdem habe ich mich damals einen Spaziergang lang einer Fantasie hingegeben:
Woody Allen begeistert sich wider Erwarten tatsächlich für meinen Roman und nimmt Kontakt auf. Man trifft sich. Zwei Männer, die von Frauen schwärmen. Das wäre ein Treffen mit dem Mann meines Lebens nach meinem Geschmack. Keine alberne Bewunderung, sondern Fachsimpelei.
In Form von Romanen dem Regisseur Frauenfiguren liefern, die dieser auf die Leinwand bringt. Penelope Cruz? Bitte nicht, die ist zu schön, die kann der Held doch nicht betrügen! Scarlett Johannsen? Dieses Kälbchen können Sie mir nicht antun, Woody, dann gebe ich die Verfilmungsrechte nicht her!
Eine große Verlegerfigur oder ein mächtiger Kritiker, der einem gewogen ist, ein weltberühmter Filmregisseur, der gern meine Romane verfilmt und damit für ihre Verbreitung sorgt, das wären Männer des Lebens, von denen man durchaus träumen kann, wie man ja auch von Traumfrauen träumt. Wirklich entscheidend aber ist sowieso nur der Zufall. Der Makler hat mein Leben geprägt, der vor ungefähr dreißig Jahren bei der Wohnungssuche entschied, dem alten Vermieter einen Schriftsteller mit Frau und Kind und Hund vorzuschlagen und nicht einen Richter mit regelmäßigem Einkommen. Oder war es eine Maklerin? Nichts hatte eine größere Bedeutung und mehr Einfluss auf den Verlauf meines Lebens als die Wohnung, in der ich zufällig lebe. Wenn es mich in einen anderen Stadtteil verschlagen hätte, würde ich ziemlich sicher ein Dutzend guter Freunde nicht kennen, sondern andere. Ich hätte andere Ferienorte bereist, andere Filme gesehen, andere Bücher gelesen, andere Bücher geschrieben. Andere Bücher hätten mir andere Leser eingebracht.
Ich weiß nicht, ob die Musik in meinen Büchern diese Rolle spielen würde, wenn es nicht einen bestimmten Freund in der Nachbarschaft gäbe, den ich vermutlich nicht hätte, wenn ich woanders wohnen würde. Ist der nun ein Mann meines Lebens oder der Makler, dem die Wohnung zu verdanken ist? Ohne die Musik in meinen Romanen wäre mein Leben anders verlaufen. Ich würde hundert Leute nicht kennen und hätte viele schöne Geschichten nicht erlebt. Auch diesen Text hier würde ich nicht schreiben.
5.
Da meine Suche nach einer prägenden männlichen Gestalt bisher nicht sehr ergiebig war, bin ich schon auf die Idee verfallen, versuchsweise den Tod zum Mann meines Lebens zu erklären. An den freiwillig selbstgewählten Tod denkt man doch immer mal wieder, seitdem man denken kann. Der Tod ist ein wahrhaft würdiger Begleiter. Der Sensenmann ist absolut zuverlässig und präsent, anders als dieser ominöse Gott, der durch Abwesenheit glänzt. Über den Tod schrieb Rilke ein Gedicht:
Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.
Das Gedicht ist nicht nur buchstäblich zu weinerlich, es enthält auch ein falsches Bild: Der Tod meldet sich zwar immer wieder in uns zu Gehör, so weit, so richtig, aber sicherlich nicht weinend. Der Tod weint nicht, eher wird er quengeln und allenfalls greinen wie ein von Blähungen geplagter Säugling. Akzeptabler wäre der Schluss des Gedichts so:
Wenn wir uns mitten im Leben tummeln,
wagt er zu grummeln
mitten in uns.
Gevatter Tod, der ab und zu mit kindischen oder senilen Lauten auf sich aufmerksam macht, wie der Magen seltsame Geräusche von sich gibt, wenn man Hunger hat – das wäre nicht die schlechteste Wahl für den Mann des Lebens. Herr von Ableben, darf ich bitten! Allerdings ist der Tod in den romanischen Sprachen weiblich. Typisch mediterrane Muttersöhnchen. La morte. La mort. »C’est la mort qui console, hélas! et qui fait vivre«, schreibt Baudelaire.
Aber selbst wenn der Knochen- oder Sensenmann vom Barock bis zu Baudelaire und Rilke in der Lyrik als belebender Tröster gefeiert wird, ist und bleibt er doch auch ein jämmerliches Gespenst, das die Auszeichnung »Mann meines Lebens« nicht verdient hat.
Besser, sich immer wieder mal eine Romanfigur zum Mann eines Lebensabschnitts zu wählen. Für mich als Kind waren es Winnetou und Lederstrumpf, später irgendwelche Nihilisten bei Beckett, Hamsun und Dostojewskij. Sogar der entsetzlich faule Oblomow war in der Pubertät eine Zeit lang mein leuchtendes Vorbild. Im Augenblick schwärme ich für eine Figur aus der Bibel, eine der wenigen wirklich erfreulichen und vorbildlichen Erscheinungen dieser Kampfschrift.
Genesis: Rebekka bekommt Zwillinge: Der erstgeborene Sohn spielt in der archaischen Gesellschaft die erste Geige. Was nachkommt, ist nicht groß der Rede wert.
Bei Zwillingen könnte es kompliziert werden. Wer macht das Kopf-an-Kopf-Rennen? Hier mischt sich wieder einmal der Herrgott persönlich ein und entscheidet raunend:
»Der Ältere wird dem Jüngeren dienen.« Aus jedem der Kinder, sagt Gott voraus, wird ein Volk hervorgehen, und »ein Volk wird dem andern überlegen sein«. Gott kann es nicht lassen. Er bringt wieder eine seiner unvermeidlichen Bevorzugungen an, die irgendwann zu Mord und Totschlag führen müssen.
Der Jüngere soll dem Älteren überlegen sein? Rätselhafte und geradezu revolutionäre Worte. Das gab es noch nie. Aushebelung des Erstgeburtsrechts. Man kann gespannt sein. Esau ist der Erstgeborene, gleich hinterher kommt Jakob, der schon im Mutterleib unangenehm auffällt, weil er den Esau nicht als Ersten herauslassen will.
Esau wird Jäger, Jakob ein braver Landmann. Papa Isaak mag Esau, weil er gern Wildbret speist, Mama mag Jakob, weil der so sanft und häuslich ist. Dann das erste dicke Ding: Jakob kocht Linsen. Esau kommt hungrig von der Jagd. »Krieg ich was von den Linsen?« Darauf Jakob, ganz schlaues Bäuerchen: »Nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst.« Darauf Esau: »Ich muss doch sterben; was soll mir denn die Erstgeburt?« Wunderbar souverän, wie sich Esau nicht um idiotische Traditionen kümmert. Sein Mann des Lebens ist der Tod, das macht ihn so gelassen. Im Kontext der Bibel erscheint Esau allerdings als Verächter eines Vorteils. Für ein Linsengericht etwas Wertvolles verkaufen, das ist zu einer Redewendung geworden.
Diese Szene zeigt, dass Gottes Weissagung nur mithilfe einer Gaunerei in Erfüllung gehen kann. Das Erstgeburtsrecht allein genügt jedoch nicht. Ohne den Segen des Vaters ist dieses Recht nichts wert. Ein weiterer Betrug ist fällig: Papa Isaak ist alt und glaubt, bald sterben zu müssen.
Bei dem Alter, das die biblischen Gestalten erreichen, dauert es meist Jahrzehnte, bis es so weit ist. Er will seinen erstgeborenen Sohn Esau segnen, vorher möchte er ein leckeres Stück Wild essen, das Esau für ihn schießen soll.
Mama Rebekka hat gelauscht und schiebt ihren Liebling Jakob vor. Der verkleidet sich als Esau und gibt sein Ziegensteak als Gazellenfleisch aus. Streng gewürzt vermutlich.
Isaak hat schlechte Augen, er ist etwas irritiert, segnet dann aber doch Jakob, den vermeintlichen Esau. Der Segen ist natürlich verbunden mit allerlei prophezeiten Herrschaftsansprüchen: »Völker müssen dir dienen. Sei ein Herr über deine Brüder, und deiner Mutter Kinder müssen dir zu Fuße fallen.« Den Betrug Jakobs sieht Gott mit Wohlgefallen. Er hat ja gleich gesagt, dass in diesem Fall der Jüngere der Stammhalter sein soll. Hier haben wir den ersten Fall einer self-fulfilling prophecy. Gott erscheint als Komplize eines Schurkenstücks, ganz Ebenbild des Menschen. Kein Wunder, dass die Kirche später eine kriminelle Vereinigung wurde.
Gäbe es einen Preis für die beste Nebenrolle in der Genesis, so wäre unbedingt Esau zu nominieren. Zwar gelüstet es ihn – was man gut verstehen kann – in einer kleinen Aufwallung, seinem hinterfotzigen Brüderchen den Hals umzudrehen, aber ein Mann wie er kann auf den Segen des Vaters gut verzichten. Der ganze Quatsch mit dem Erstgeburtsrecht geht ihm nach wie vor am Arsch vorbei.
Er steht über solchen Archaismen. Schon vorher hatte er zwei Frauen geheiratet, die seinen spießigen Eltern nicht passten. Dunkle Hethiterinnen. Pfui. »Die machten Isaak und Rebekka eitel Herzeleid.« Sicher waren sie wild und schön und mokierten sich über die spießigen Schwiegereltern.
Seltsam beziehungsweise typisch, dass Esau nicht zu einem beliebten männlichen Vornamen wurde. Millionen Leute heißen Jakob, obwohl das der Name eines Gauners ist. Es wird Zeit, die Söhne Esau zu nennen. Esau ist ein freier Mann. Er pfeift auf Konventionen und die Pläne seiner Eltern. Wenn Jakob Türke wäre, wäre er der Typ, der auf Befehl des Familienrats, ohne zu zögern, gehorsam den Ehrenmord an der sündigen Schwester vollzieht. Esau würde sich weigern und seinen Vater ohrfeigen, wenn er ihm damit käme. Nicht einmal Luther hat erkannt, was in dieser Figur steckt, obwohl gerade ihm als chronischem Antisemiten doch hätte auffallen müssen, wie lächerlich jüdisch rasserein sich Bruder Jakob verhält und wie weltläufig und quasi multikulturell sich Esau einen Dreck um das penetrante Gerede vom auserwählten Volk hinwegsetzt.
Wenn ich Luther gewesen wäre, ich hätte mich Martin Luther Esau genannt.Esau zieht mit seinen schönen wilden Frauen in die Ferne. Einmal noch führt ihn sein Weg zurück. Jakob bekommt sofort die Panik. Sein betrogener Bruder wird sich nun rächen, wird ihn und seine ganze Sippschaft vernichten.
So denken sie, die kleinkarierten Betrüger. Mit seinen kostbaren Viehherden zieht Jakob dem Bruder entgegen.
Die einzige Chance. Er wird ihm all die Tausend Kamele und Ziegen und andere erschlichene Reichtümer anbieten und ihn anflehen, ihn und seine Familie am Leben zu lassen. Es gibt wunderbare Kupferstiche aus dem 16. Jahrhundert, die das Geschehen illustrieren. Jakob fällt vor Esau auf die Knie und bettelt um Schonung. Bis zum Horizont alles voller Viehherden, mit denen er sich freikaufen will. Und Esau sagt: »Steh auf, was hast du denn, lass mich mit deinen albernen Viechern in Ruhe, die brauch ich nicht, ich kam doch nur zufällig in der Gegend vorbei und wollte meinem Brüderchen mal Hallo sagen.«
Cool. Stark. Super. Große Klasse. Esau, du bist mein Mann! Ich wünsche mir einen Film der Coen-Brüder über die Geschichte der Brüder Jakob und Esau. Zum Aufblicken und Anhimmeln ist Esau nicht der Richtige.
Ihm auf gleicher Augenhöhe zu begegnen verbietet sich schon deswegen, weil der eigentlich schöne Ausdruck »auf gleicher Augenhöhe« zu einer Plappermetapher politischer Kommentatoren geworden ist. Als ein Mann für gewisse Stunden meines Lebens wäre Esau gut geeignet. Muss ja nicht gleich eine Männerfreundschaft daraus entstehen. Männerfreundschaften riechen immer nach Bier.
Aber einen Nachmittag lang mit Esau durch Feld und Wald zu schweifen, ein Liedchen mit ihm »wegzupfeifen«, wie es im Goethe Schubert’schen Musensohn nicht unrockig heißt – das hätte was. In einer Spelunke zwei Flaschen Wein mit ihm trinken, den Wirt überreden, uns trotz Rauchverbots qualmen zu lassen, und dabei ein wenig über Vorteile des Ungehorsams räsonieren – warum nicht? Und dann geht jeder wieder seiner Wege.
Joseph von Westphalen Auf der Suche nach dem Supermann
Erschienen in: Der Mann meines Lebens
© 2011 Kein & Aber AG. Zürich, Berlin.
www.keinundaber.ch
Joseph von Westphalen, geboren 1945, Schreibtisch in München. Diverse Romane, daneben ständig journalistische Texte für seriöse und unseriöse Blätter. Ab und an packt der Autor seinen erotischen Jazzkoffer und spielt als DJ zum Tanz auf. Zuletzt bei Kein & Aber erschienen Wie man mit Jazz die Herzen der Frauen gewinnt.
Der Mann meines Lebens.
Beiträge von Jakob Hein, Mikael Krogerus, Dieter Meier,
Nils Minkmar, Dieter Moor, Cord Riechelmann, Harry Rowohlt, Robert Seethaler, Claudius Seidl, Fabio Stassi, Philipp Tingler, Joseph von Westphalen, Christian Zaschke.
Kein & Aber 2011.
240 S., Hardcover, CHF 27.90. 19.90 Euro.
ISBN 978-3-0369-5564-3