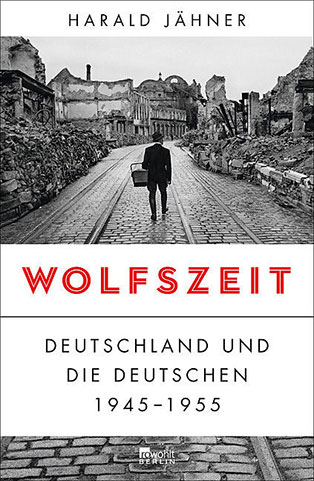
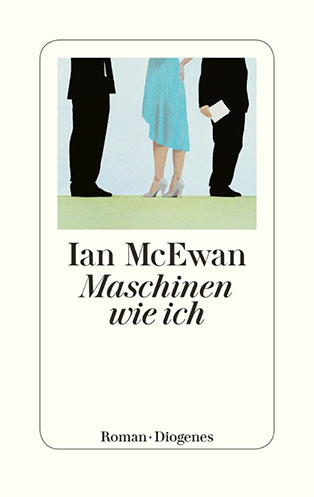

«Wolfszeit: Deutschland in der Stunde Null 1945-1955»
Von Ingrid Isemann
So viel Anfang war nie. So viel Ende auch nicht. Harald Jähners fundamentale Zeitgeschichte der ersten zehn Nachkriegsjahre nach 1945 in Deutschland zeigt den schwierigen Neubeginn mit «Anschaulichkeit, dramaturgischem Gespür und Eloquenz», so die Jurybegründung für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse.
Ein Land in Auflösung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 aus einem totalitären Nazi-Regime wurde das Land in vier Besatzungszonen der Alliierten aufgeteilt. Wie kann aus diesem Chaos je wieder eine Gesellschaft entstehen? Dem Tod entronnen zu sein, versetzt in Apathie, aber auch in eine nie gekannte Lebensgier und Daseinsfreude. Das Leben ist aus den Fugen, aber die Menschen probieren den Neuanfang. Man legt sich eine neue Identität zu und fängt bei null an.
Wie das «Wirtschaftswunder» und die soziale Marktwirtschaft zwischen Schwarzhandel, Währungsreform und Entnazifizierungsmassnahmen entstand, wird mit reichhaltigem Quellenmaterial dokumentiert, u.a. Tagebücher, Theaterstücke («Draussen vor der Tür» von Wolfgang Borchert über das Elend der Kriegsheimkehrer), Romane, Filme, Gedichte und Lieder, wie sich die («Trümmer»)Frauen emanzipierten. Das ist spannend und detailgetreu zu lesen. Die Deutschen litten in jenen Jahren weniger an Schuldgefühlen als am Leid der eigenen Verluste und der eigenen Misere. Rückblicke auf die Zeitgeschichte und die Auswirkungen auf die Gegenwart zeigen, dass jene Zeit mehr mit der heutigen Gesellschaft und Politik zu tun hat als vielleicht gedacht. Die kürzlichen Gedenktage anlässlich der vor 75 Jahren erfolgten Invasion der britischen, amerikanischen und kanadischen Streitkräfte in der Normandie am D-Day am 6. Juni 1944 zeigen, wie wach die Erinnerung über die Schlachten gegen das Nazi-Regime heute noch ist.
Der Theaterkritiker Friedrich Luft erlebte das Kriegsende im Keller einer Stadtvilla in der Nähe des Berliner Nollendorfplatzes unter dem wechselseitigen Beschuss durch Rote Armee und Wehrmacht: «Draussen war das Inferno, lugt man hinaus, sah man einen hilflosen deutschen Tank sich durch die Glut der Häuserzeilen schieben, halten, schiessen, beidrehen. Hin und wieder stolperte ein Zivilist, von Deckung zu Deckung stürzend, über den aufgeborstenen Fahrdamm. Eine Mutter jagte mit ihrem Kinderwagen aus einen ausgeschossenen, brennenden Haus in die Richtung des nächsten Bunkers».
Bausteine einer freieren Welt – Schicksale und Lebensentwürfe
Die Kapitel über befreite Zwangsarbeit, die Vertriebenen und die schockierende Begegnung der Deutschen mit sich selbst, die Heimkehr der ausgebrannten Männer, die ersten Umverteilungen und das Plündern, der Schwarzmarkt als Staatsbürgerschule, die symbolhaften Nierentische, der Erotik-Versandhandel von Beate Uhse, die Generation Käfer, die umerziehenden Schriftsteller wie Alfred Döblin und Kulturbeauftragte im Sinne der Alliierten, der Kalte Krieg und das Design der Demokratie, Verdrängung, die neue Tanzwut und das Glück sind aufregende, bestimmende Wegmarken auf dem Weg zu einem neuen Staat, der Bundesrepublik Deutschland.
Leseprobe. Auszug aus dem ersten Kapitel «Stunde Null?»
Hinter diesem wilden Schrei nach Neuanfang liegt das Ende
eines Infernos, von dem man überall nur einen winzigen
Ausschnitt mitbekommen hatte. An dessen Beschreibung
arbeitet inzwischen die dritte Generation von Historikern,
um die Dimensionen der Schrecken annähernd begreifbar
zu machen. Sie bleiben unvorstellbar. Niemand
kann nachvollziehen, was 60 Millionen Kriegstote bedeuten.
Es gibt Eselsbrücken, um wenigstens das statistische
Ausmaß fassbarer zu machen. 40 000 Menschen starben
bei dem Hamburger Feuersturm während der Bombardierungen
im Sommer 1943 – eine Hölle, die sich wegen ihrer
grausamen Bildlichkeit tief ins Gedächtnis eingegraben
hat. Sie raubte etwa drei Prozent der Hamburger Bevölkerung
das Leben. So schrecklich diese Ereignisse auch waren,
die gesamteuropäische Opferrate war mehr als doppelt
so hoch. Der Krieg kostete sechs Prozent aller Europäer das
Leben. Die Dichte der Katastrophe, die Hamburg ereilte,
galt für Europa, aufs Ganze gesehen, in doppeltem Maße.
In Polen war sogar ein Sechstel der Einwohner getötet worden,
sechs Millionen Menschen. Am schlimmsten erging es
den Juden. In ihren Familien zählte man nicht die Toten,
sondern die Überlebenden.
Der Historiker Keith Lowe schreibt: «Selbst jene, die den
Krieg erlebten, Zeugen von Massakern wurden, mit Leichen
übersäte Felder oder mit Körpern gefüllte Massengräber
sahen, können das wahre Ausmaß der Massentötung,
die in Europa stattfand, nicht begreifen.» Das galt
erst recht unmittelbar nach Kriegsende. Mit dem Chaos,
das jeder Einzelne vorfand, als er mit erhobenen Armen aus
dem Luftschutzkeller stieg, war er überfordert genug. Wie
sollte je wieder etwas aus diesem Unheil werden, zumal in
Deutschland, das die Schuld an allem trug? Es gab nicht
wenige, die das schlichte Weiterleben als Unrecht begriffen
und, rhetorisch zumindest, ihr Herz hassten, weil es weiterschlug.
Doch ausgerechnet der 26-jährige Wolfgang Borchert,
den die Nachwelt als einen düsteren Fachmann der Klage in
Erinnerung behalten sollte, versuchte, die Last des Weiterlebens
in ein emphatisches Manifest seiner Generation zu
verwandeln. Borchert war 1941 in die Wehrmacht eingezogen
und an die Ostfront geschickt worden. Mehrfach wurde
er dort wegen «wehrkraftzersetzender Äußerungen» bestraft.
Schwer gezeichnet von den Front- und Hafterlebnissen
und von einer unbehandelt gebliebenen Lebererkrankung,
kehrte er 1945 nach einem 600 Kilometer langen
Fußmarsch nach Hamburg zurück. Dort schrieb er den anderthalbseitigen Text «Generation ohne Abschied». Er besang
darin mit wilder Entschlossenheit den Aufbruch einer
Generation, deren Vergangenheit buchstäblich weggeschossen
war. Sie stand, das meint der Titel «Generation
ohne Abschied», der Psyche nicht mehr zur Verfügung, sei
es durch Unvorstellbarkeit, Traumatisierung oder schnöde
Verdrängung. «Generation ohne Abschied» ist ein Manifest
der Stunde Null: «Wir sind die Generation ohne Bindung
und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist Abgrund. Wir sind die Generation
ohne Glück, ohne Heimat und ohne Abschied. Unsere
Sonne ist schmal, unsere Liebe grausam, unsere Jugend
ist ohne Jugend.»
Borcherts rhapsodischer, monoton dahinhämmernder
Text ist geprägt von einer mit Elan aufgeladenen Orientierungslosigkeit.
Nicht ohne Stolz stilisiert er einen Habitus verwegener Kälte. Zu oft habe diese Jugend Abschied von den Toten genommen, um Abschied noch empfinden zu können;
in Wahrheit seien die Abschiede «Legion». Die letzten
Zeilen des Textes berichten von der Kraft, die selbst
dieser todkranke junge Mann für die Zukunft aufzubringen
gedachte: «Wir sind eine Generation ohne Heimkehr, denn
wir haben nichts, zu dem wir heimkehren könnten. Aber wir
sind eine Generation der Ankunft. Vielleicht sind wir eine
Generation voller Ankunft auf einem neuen Stern, in einem
neuen Leben. Voller Ankunft unter einer neuen Sonne, zu
neuen Herzen. Vielleicht sind wir voller Ankunft zu einem
neuen Leben, zu einem neuen Lachen, zu einem neuen Gott.
Wir sind eine Generation ohne Abschied, aber wir wissen,
dass alle Ankunft uns gehört.»
«Generation ohne Abschied» ist die poetische Grundsatzerklärung
einer Kohorte von Übriggebliebenen, die keinen
Nerv für den Rückblick hat. Die schockierende Weigerung
vieler Deutscher, sich zu fragen, wie das alles hatte
geschehen können, wird hier geradezu zum Programm erhoben.
Die Tafel des Erlebten wird ausgewischt, frei gemacht
für eine neue Schrift, «einen neuen Gott». Ankunft
auf einem neuen Stern.
Das Wort «Verdrängung» wäre hier untertrieben. Sie
ist bewusstes Programm. Hier wird emphatisch angefangen und bitter Schluss gemacht. Dass die Tabula rasa eine
Illusion ist, eine bloße Wunschvorstellung, wusste Wolfgang
Borchert natürlich genau. Was quälende Erinnerungen
sind, musste ihm niemand erklären. Das Vergessen war
die Utopie der Stunde.
Ein Gedicht der Stunde Null hat es sogar zu einem manifestartigen
Status gebracht. Es ist die berühmte «Inventur»
von Günter Eich, verfasst Ende 1945. Ein Mann zählt darin
seine Habe auf, seine Ausstattung für den Neubeginn.
«Dies ist meine Mütze,
dies ist mein Mantel,
hier mein Rasierzeug
im Beutel aus Leinen.
(…)
Im Brotbeutel sind
ein paar wollene Socken
und einiges, was ich
niemandem verrate.
(…)
Dies ist mein Notizbuch,
dies meine Zeltbahn,
dies mein Handtuch,
dies ist mein Zwirn.»
Zum Inbegriff der Nachkriegsliteratur wurde «Inventur»
wegen seiner aufreizenden Lakonie. Die «Kahlschlagliteraten», wie sie sich selber nannten, opponierten gegen große
Töne, weil sie sich von ebensolchen, einst selbst im Mund
geführt, betrogen fühlten. Auch die Begeisterungsfähigkeit
lag in Trümmern. Nur noch ans Einfachste wollte man sich
nun halten und ans Eigene, an das, was man auf dem Tisch
ausbreiten konnte – eine lyrische Proklamation der «skeptischen
Generation», die der Soziologe Helmut Schelsky
1957 mit großer Resonanz in all ihrer mentalen Ambivalenz aus der Taufe holen sollte. Auch Günter Eichs lyrische
Bestandsaufnahme vermeidet Erinnerung: Mit nichts
als Misstrauen sowie Mantel, Bleistift und Zwirn (und mit
etwas, «das ich niemandem verrate» – eine Wendung, die
der eigentliche Clou des Textes ist) geht es ins neue Leben.
Auch Marta Hillers machte in ihrem Tagebuch Inventur.
Es ist berühmt geworden wegen der Nüchternheit und
Offenheit, mit der sie die Welle der Vergewaltigungen beschrieb,
die mit dem Einmarsch der Roten Armee einherging.
Die Stunde Null erlebte sie als tagelanges sexuelles
Gewaltregime. Als es endlich überstanden war, zog sie am
13. Mai Bilanz:
«Auf der einen Seite stehen die Dinge gut für mich. Ich
bin frisch und gesund. Es hat mir physisch nichts geschadet.
Hab das Gefühl, als sei ich bestens für das Leben ausgerüstet,
als hätte ich Schwimmhäute für den Modder. Ich
passe in die Welt, bin nicht fein. (…) Auf der anderen Seite
stehen lauter Minuszeichen. Ich weiß nicht mehr, was
ich noch auf der Welt soll. Ich bin keinem Menschen unentbehrlich, stehe bloß so herum, warte, sehe derzeit weder
Ziel noch Aufgabe vor mir.» Sie spielt einiges an Möglichkeiten
durch: Nach Moskau gehen, Kommunistin werden
oder Künstlerin? Alles verwirft sie. «Die Liebe? Die liegt
zertreten am Boden. (…) Die Kunst? Ja für die Berufenen,
zu denen ich nicht zähle. Bin nur ein kleiner Handlanger,
muss mich bescheiden. Einzig im engen Kreis kann ich wirken
und gut Freund sein. Der Rest ist Warten auf das Ende.
Trotzdem reizt das dunkle und wunderliche Abenteuer des
Lebens. Ich bleibe schon aus Neugier dabei; und weil es
mich freut zu atmen und meine gesunden Glieder zu spüren.»
Und Friedrich Luft? Der Theaterkritiker, der Ende April
mit weißer Armbinde aus dem Keller gestiegen und den russischen Soldaten entgegengegangen war, blieb auch dabei,
mit unstillbarer Neugier. Für das Feuilleton des im September 1945 gegründeten Berliner «Tagesspiegel» schrieb
er regelmäßig Glossen unter dem Pseudonym Urbanus. Da
ging es um das erotische Fluidum der Großstadt, um die
schönen Kleider im Frühjahr, um die gespannte Erwartung,
wenn morgens der Briefträger kommt.
Friedrich Luft war die «Stimme der Kritik» beim Westberliner
RIAS. Von Februar 1946 bis zum Oktober 1990,
kurz vor seinem Tod, beendete er jede seiner wöchentlichen
Sendungen mit einem Satz, der den Hörern wie Honig in
die Seelen träufelte, weil er Verlässlichkeit versprach: «Wir
sprechen uns wieder in einer Woche. Wie immer. Gleiche
Zeit, gleiche Welle, gleiche Stelle.»
Friedrich lebte mit seiner Frau, einer Zeichnerin, noch
viele Jahrzehnte in dem Haus, aus dessen Keller er 1945
gestiegen war. In den frühen siebziger Jahren zog es Heide
Luft des Öfteren in eine Kneipe am Winterfeldtplatz, nicht
weit von ihrem Wohnhaus entfernt. Das Lokal hieß Ruine.
Es hieß nicht nur so, es war auch eine: Das Vorderhaus
war noch immer weggebombt, seine Grundmauern standen
aber in Teilen und bildeten mit ihren schartigen Wänden einen
bizarren kleinen Biergarten. Im Hinterhaus befand sich
die Gaststube, stets rappelvoll. Ein Baum wuchs aus dem
zugeschütteten Keller des Vorderhauses, und es hatte sich
angeboten, ein paar Glühlampen aufzuhängen. Die Kneipe
war Anfang der Siebziger ein Treffpunkt von Leuten, die
mal Dichter werden wollten. Meist waren es Studenten. Es
sah aus, als hätte der Krieg gerade eben erst aufgehört.
Während ihr Mann daheim an seinen Kritiken fürs Radio
feilte, saß Frau Luft in ihrem eleganten Pelzmantel unter
den langhaarigen Leuten, parlierte ein bisschen, stets gescheit
und unverbindlich, und gab manchmal einen aus. Sie
war eine von vielen, die gern zur Stunde Null zurückkehrten,
jeder auf seine Weise.
Harald Jähner, geboren 1953, war bis 2015 Feuilletonchef der «Berliner Zeitung», der er seit 1997 angehörte. Zuvor war er freier Mitarbeiter im Literaturressort der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Seit 2011 ist Jähner Honorarprofessor für Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin.
Harald Jähner
Wolfszeit
Deutschlad und die Deutschen 1945-1955
Rowohlt, Berlin 2019
475 S., geb. CHF 41.90
ISBN 978-3-7371 0013-7
«Ian McEwan: Maschinen wie ich»
Ethik und künstliche Intelligenz sind ein hochbrisantes Thema. Können Maschinen lieben? Und traurig sein? Eine menage-à-trois in einer neuen Variante mit einem Protagonisten der KI künstlichen Intelligenz. Mitspieler Charlie, ein sympathischer Lebenskünstler Thirty something und Miranda eine smarte Studentin, die mit einem dunklen Geheimnis leben muss. Sie verlieben sich gerade dann, als Charlie seinen ‚Adam‘ bekommt, einen fast lebensechten Androiden.
In ihrer Liebesgeschichte gibt es von Anfang an einen Dritten: ‚Adam‘. Kann eine Maschine denken, leiden, lieben? Adams Gefühle und seine moralischen Prinzipien bringen Charlie und Miranda in ungeahnte und verhängnisvolle Situationen.
Ian McEwan entwirft mit einem Kunstgriff in seinem kühnen Roman die Vergangenheit neu. London 1982: Grossbritannien hat den Falkland-Krieg verloren (statt gewonnen), und dank der Forschung von Computer-Pionier Alan Turing gibt es Anfang der achtziger Jahre schon Internet, Handys und selbstfahrende Autos, und die ersten täuschend echten künstlichen Menschen.
Charlie, ein sympathischer Lebenskünstler Anfang 30, ist seit seiner Kindheit von künstlicher Intelligenz fasziniert, Alan Turing ist sein Idol. Auch wenn es ihn ein kleines Vermögen kostet, kauft er sich sofort einen der ersten Androiden, die auf den Markt kommen. Charlie wünscht sich einen Freund, einen Helfer, einen interessanten Gesprächspartner. Er erhält viel mehr als das: einen Rivalen um die Liebe der schönen Miranda und eine moralische Herausforderung, die ihn bis zum Äussersten reizt. Ian McEwan hält uns in diesem so philosophischen wie fesselnden Roman einen doppelten Spiegel vor – als Menschen und als Zeitgenossen sehen wir uns darin zuweilen klarer, als uns lieb ist.
Leseprobe:
Es war der Hoffnungsschimmer einer religiösen Sehnsucht, es war der Heilige Gral der Wissenschaft. Unsere höchsten und niedersten Erwartungen wurden geweck t von diesem wahr gewordenen Schöpfungsmythos, diesem ungeheuerlichen Akt der Selbstverliebtheit. Kaum war es machbar, blieb nichts weiter übrig, als unserem Verlangen nachzugeben und auf die Folgen zu pfeifen. Pathetisch gesagt strebten wir danach, unserer Sterblichkeit zu entrinnen, Gott mit seinem perfekten Ebenbild zu konfrontierenoder gar zu ersetzen. Praktischer gedacht wollten wir eine verbesserte, modernere Version unserer selbst schaffen und die Freuden des Erfindens geniessen, das Hochgefühl wahrer Meisterschaft. Im Herbst des zwanzigsten Jahrhunderts war es endlich so weit: Der erst Schritt zur Erfüllung eines uralten Traums war getan, und es begann jene lange Lektion, die uns lehrte, dass wir – wie kompliziert wir auch sein mochten, wie fehlerhaft und selbst in unseren einfachsten Handlungen, unserem schlichtesten Sein so schwer zu beschreiben – dennoch kopiert und verbessert werden konnten. Und ich war dabei in jener kühlen Morgend.mmerung, ein eifriger Nutzer der ersten Stunde.
Künstliche Menschen waren ein Klischee schon lange, bevor es sie gab, weshalb sie manche, als sie dann endlich da waren, enttäuschend fanden. Die Phantasie, so viel schneller als die Historie, als jeder technologische Fortschritt, hatte diese Zukunft bereits in Büchern durchgespielt, dann im Kino und Fernsehen, als könnten uns menschliche Schauspieler mit glasigem Blick, ruckartigen Kopfbewegungen und steifem Kreuz auf das Leben mit unseren Vettern aus der Zukunft vorbereiten.
Ich gehörte zu den Optimisten und sah mich nach dem Tod meiner Mutter und dem Verkauf des Familienhauses, das, wie sich erwies, auf wertvollem Bauland stand, mit unverhofftem Reichtum gesegnet. Der erste wirk lich funktionsfähige künstliche Mensch mit überzeugender Intelligenz und glaubhaftem Äusseren, mit lebensechter Motorik und Mimik kam auf den Markt, eine Woche ehe unsere Truppen zu ihrer hoffnungslosen Falkland-Mission aufbrachen.
Adam kostete 86 000 Pfund. Ich brachte ihn in einem gemieteten Transporter zu meiner schäbigen Wohnung in North Clapham. Es war eine leichtsinnige Entscheidung gewesen, befeuert von Berichten, dass sich Sir Alan Turing Kriegsheld und grösstes Genie des digitalen Zeitalters, dasselbe Modell hatte liefern lassen. Bestimmt wollte er es in seinem Labor auseinandernehmen, um genau zu sehen, wie es funktionierte.
Zwölf Exemplare dieser ersten Produktionsreihe hiessen Adam, dreizehn Eve. Nicht gerade originell, da war man sich einig, aber verkäuflich. Da biologische Vorstellungen von Rasse wissenschaftlich in Verruf geraten waren, hatte man beim Design der fünfundzwanzig darauf geachtet, eine möglichst grosse Bandbreite an Ethnien abzudecken.
Es gab erst Gerüchte, dann Beschwerden, dass der Araber nicht vom Juden zu unterscheiden war. Zufallsprogrammierung in Kombination mit Lebenserfahrung würde jedem Exemplar hinsichtlich sexueller Präferenzen eine freie Wahl garantieren. Die Eves waren nach einer Woche schon ausverkauft. Meinen Adam hätte man flüchtig besehen für einen Türken oder Griechen halten können. Da er 85 Kilo wog, musste ich Miranda, meine Nachbarin, bitten, mir zu helfen, und gemeinsam schleppten wir ihn auf einer mitgelieferten Einmal trage von der Strasse in die Wohnung.
Während sich die Batterien aufluden, setzte ich uns Kaffeewasser auf und scrollte dann durch das 470 Seiten starke Online-Handbuch. Es las sich grösstenteils klar und präzise. Allerdings hatte man Adam in verschiedenen Werkstätten zusammengesetzt, weshalb manche Instruktionen den Charme eines Unsinnsgedichts besassen: «Vorderteil des B347k Leibchens entblössen, um mit dem sorglos Emoticon des Motherboard Outputs die Stimmungsschwankungen der Penumbra zu mindern».
Endlich sass er, einen Haufen Styropor und Plastik um die Knöchel, an meinem kleinen Esstisch, nackt, die Augen geschlossen. Ein schwarzes Stromkabel schlängelte sich von der Buchse, seinem Bauchnabel, zu einer Dreizehn-Ampere-Steckdose an der Wand. Ihn voll aufzuladen, würde sechzehn Stunden dauern. Dann noch die Update-Downloads und die Festlegung persönlicher Präferenzen. Ich wollte ihn jetzt, sofort, Miranda auch. Wie aufgeregte junge Eltern waren wir begierig, seine ersten Worte zu hören. Es gab keinen billigen, in seiner Brust versenkten Lautsprecher.
Aus der enthusiastischen Werbung wussten wir, dass er mit Atemluft, Zunge, Zähnen und Gaumen Töne formte. Seine lebensechte Haut fühlte sich bereits warm und so weich an wie die eines Kindes. Miranda behauptete, ein Zucken seiner Wimpern beobachtet zu haben. Ich war mir sicher, dass es nur die Vibrationen der Untergrundbahn waren, die dreissig Meter unter uns dahindonnerte, sagte aber nichts.
Adam war kein Sexspielzeug. Dennoch war er zu Sex fähig und besass funktionierende Schleimhautmembranen, für deren Versorgung er jeden Tag einen halben Liter Wasser benötigte. Mir fiel auf, dass er unbeschnitten war, recht gut bestückt, das Schamhaar voll und dunkel. Dieses hochentwickelte Modell eines künstlichen Menschen verkörperte vermutlich, was seinen jungen Programmierern gefiel, und den Adams und Eves wurde nachgesagt, überaus temperamentvoll zu sein. Die Werbung pries ihn als Gefährten an, als intellektuellen Sparringspartner, als Freund und ein Faktotum, das den Abwasch machen, Betten beziehen und ›denken‹ konnte. Jeden Augenblick seiner Existenz, alles, was er hörte und sah, nahm er auf, jederzeit wieder abrufbar. Auto fahren konnte er noch nicht, und er durfte auch nicht schwimmen, duschen, ohne Schirm im Regen stehen oder unbeaufsichtigt mit einer Kettensäge hantieren. Was die Laufzeit betraf, konnte er, dank einem Durchbruch in der Batterieentwicklung, mit einer Akkuladung siebzehn Kilometer in zwei Stunden rennen oder sich – das energetische Äquivalent – zwölf Tage lang pausenlos unterhalten. Seine Lebensdauer war auf zwanzig Jahre angelegt. Er war kompakt gebaut, breitschultrig, hatte einen dunklen Teint und dichtes, schwarzes, nach hinten gekämmtes Haar, ein schmales Gesicht mit einer leicht gekrümmten Nase, die ihn hochintelligent wirken liess, einen grüblerischen Blick unter schweren Lidern und feste Lippen, die in diesem Moment, vor unseren Augen, ihren tödlich gelbweissen Farbton verloren und eine satte, lebhafte Farbe annahmen, sich in den Mundwinkeln sogar ein wenig entspannten. Miranda meinte, e sähe aus wie «ein Hafenarbeiter vom Bosporus».
Vor uns sass das ultimative Spielzeug, der wahrgewordene Traum vieler Jahrhunderte, der Triumph des Humanismus – oder sein Todesengel. Unfassbar aufregend, aber auch frustrierend. Sechzehn Stunden waren eine lange Zeit, wenn man nur warten und zusehen konnte. Bei der Summe, die ich nach dem Mittagessen für ihn hingeblättert hatte, hätte er auch geladen und betriebsfertig sein können, fand ich. Es war ein später Nachmittag im Winter. Ich machte Toast, und wir tranken noch einen Kaffee. Miranda, die Sozialgeschichte studierte und promovieren wollte, sagte, sie wünschte, die junge Mary Shelley könnte bei uns sein und mitverfolgen, wie nicht etwa ein Ungeheuer à la Frankenstein, sondern dieser attraktive junge Mann mit dem Bronzeteint zum Leben erwachte. Ich sagte, in jedem Fall aber würden beide Kreaturen die beseelende Kraft der Elektrizität brauchen.
«Genau wie wir», sagte sie, als meine sie nur sich und mich und nicht die gesamte, elektrochemisch aufgeladene Menschheit. Sie war zweiundzwanzig, zielich erwachsen für ihr Alter und zehn Jahre jünger als ich. Mit ein wenig Abstand betrachtet schien mir das vernachlässigbar. Wir waren beide so herrlich jung. Doch sah ich mich in einem ganz anderen Lebensabschnitt als sie. Die Ausbildung hatte ich längst abgeschlossen und bereits eine Reihe beruflicher, finanzieller und persönlicher Fehlschläge hinter mir. Für eine junge, liebenswerte Frau wie Miranda fand ich mich zu abgebrüht und zynisch. Obwohl sie schön war mit ihrem hellbraunen Haar und dem langen, schmalen Gesicht, den oft vor verhaltener Heiterkeit zusammengekniffenen Augen, und auch wenn ich sie in bestimmten Stimmungen manchmal staunend anstarrte, hatte ich sehr früh entschieden, ihre Rolle in meinem Leben auf die der netten, nachbar lichen Freundin zu beschränken. Ihre winzige Wohnung lag gleich über meiner. Wir teilten uns den Eingang und trafen uns manchmal auf einen Kaffee, um über Beziehungen, Politik, Gott und die Welt zu reden. Mit perfekt austarierter Neutralität schien sie entspannt all dem entgegenzusehen, was da kommen mochte, als wäre ihr ein nachmittägliches Schäferstündchen mit mir gerade so recht wie unsere keukameradschaftlichen Gespr.che. Sie wirkte in meiner Gegenwart völlig entspannt, und ich sagte mir, Sex würde das nur ruinieren. So blieben wir gute Kameraden. Trotzdem strahlte sie etwas verlockend Geheimnisvolles, Reserviertes aus. Vielleicht war ich ja, ohne es zu wissen, schon seit Wochen in sie verliebt. Ohne es zu wissen? Was war das denn für eine fadenscheinige Formulierung?
Ian McEwan
Maschinen wie ich
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Diogenes, 2019
416 S. CHF 28. € 21.99
978-3-257-60958-5
Auch erhältlich als eBook
«Donna Leon: Ein Sohn ist uns gegeben»
Commissario Guido Brunetti ist der Traum-Schwiegersohn und Schwarm der Donna Leon-Krimifangemeinde. Die neue Story dreht sich um das Erbe Gonzalo Rodríguez de Tejedas, der im Kunsthandel ein Vermögen erwarb und seinen Lebensabend in Venedig geniesst. Wer soll ihn einst beerben? Ein aktuelles Thema.
Mit seinen Kunstschätzen fasziniert Venedig seit je. Doch wo das Geld hockt und lockt, lauert auch die Gier. Wer soll den Galeristen Gonzalo Rodríguez de Tejeda beerben, wenn er einmal nicht mehr ist? Von seiner Herkunftsfamilie hat sich der gebürtige Spanier schon lange entfernt. Die Frage stellt sich, ob die rigide Familie, die mit seinem freizügigen Lebenswandel nie einverstanden war, seine Schätze erben soll. Oder wer ist die auserwählte Person? In Venedig wurde er unlängst immer wieder in Begleitung eines jungen Mannes gesehen, der Conte Falier nicht geheuer ist. Der Conte hat seinen Schwiegersohn, Guido Brunetti, selten um einen Gefallen gebeten. Doch da Gonzalo sein Jugendfreund ist, möchte er ihn schützen. Brunetti im Zweispalt: Braver Schwiegersohn oder pflichtbewusster Polizist? Der Commissario soll helfen und verrennt sich beinahe in den Abgründen des menschlichen Herzens. Eine delikate Angelegenheit, die Brunettis ganzes Fingerspitzengefühl erfordert.
Leseprobe
Du weißt, ich mische mich ungern in anderer Leute Angelegenheiten«, begann Conte Falier, der seinem Schwiegersohn in einem jener altehrwürdigen Sessel gegenübersaß, die im Palazzo Falier überall herumstanden. »Aber in diesem Fall – wo er mir doch so nahesteht – komme ich einfach nicht umhin.« Brunetti ließ dem Älteren Zeit, da er spürte, wie schwer es dem Conte fiel vorzubringen, was er auf dem Herzen hatte. Der Conte hatte am Morgen in der Questura angerufen und gefragt, ob Brunetti nach Feierabend auf einen Drink bei ihm vorbeikommen könne, er müsse etwas mit ihm besprechen. Am liebsten wäre Brunetti bei diesem warmen Vorfrühlingswetter zu Fuß von der Questura zum Palazzo der Faliers spaziert. Doch bei dem wolkenlosen Himmel verbot sich allein schon die Riva degli Schiavoni, und die Piazza San Marco überqueren zu wollen wäre blanker Wahnsinn. Die vom Lido kommenden Vaporetti hingegen waren um diese Zeit zwar voll, platzten aber nicht mehr aus allen Nähten, und so hatte er resigniert seine Abneigung gegen öffent liche Verkehrsmittel überwunden, die Nummer eins nach Ca’ Rezzonico genommen und stand schon früh am Abend vor der Tür. »Ich halte nichts von Klatsch«, beteuerte der Conte. Brunetti horchte auf. »Grundsätzlich nicht.« »Dann lebst du in der falschen Stadt«, meinte Brunetti und lachte, um seiner Antwort die Spitze zu nehmen. »Und solltest die Venezianer meiden.« Auf dem Gesicht des Conte machte sich ein entspanntes Lächeln breit. »Ersteres stimmt nicht, wie du weißt«, sagte er und setzte, noch breiter lächelnd, hinzu: »An Letzterem könnte etwas dran sein – aber was will man machen? Es ist zu spät. Ich verkehre, seit ich denken kann, mit Venezianern.« Immer noch verwundert, dass sein Schwiegervater Klatsch über seinen besten Freund auch nur diskutieren wollte, fragte Brunetti: »Stammen diese Gerüchte über Gonzalo von einem Venezianer?« »Ja, von einem Rechtsanwalt«, räumte der Conte ein, hob aber sogleich die Hand, damit Brunetti gar nicht erst nach dem Namen fragte. »Von wem ich es gehört habe, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur die Geschichte selbst.« Brunetti nickte. Wie die meisten Venezianer war er es gewohnt, in einem Strudel aus wahren und falschen Erzäh lungen dahinzutreiben; doch anders als die meisten Venezianer hatte er keine Freude daran: Langjährige Erfahrung hatte ihn gelehrt, wie unbrauchbar das meiste war. Selbst von schlüpfrigen Geschichten, die ihn zum Erröten brachten, blieb Brunetti als Commissario nicht verschont; und als Leser waren ihm Dinge wie Suetons Schilderungen der Vergnügungen eines Tiberius wohlvertraut. Sein Verstand aber warnte ihn, dass Venezianer selbst die Taten und Untaten von Menschen ausschmückten, die sie gar nicht kannten, und unbekümmert um mögliche Folgen auch die unglaubwürdigsten Gerüchte weitererzählten. Natürlich interessierte ihn, was die Leute so anstellten, nur glaubte er dergleichen erst, wenn er hinreichend Beweise dafür hatte. Darum würde Brunetti auch alles, was man seinem Schwiegervater erzählt haben mochte, mit Vorsicht genießen, es zunächst einmal als unbewiesen ansehen, nicht als unumstößliche Tatsache. Während er darauf wartete, dass der Conte zur Sache kam, schweiften Brunettis Gedanken ab zu der Entscheidung, um die seine Familie sich seit Jahren drückte: Was sollte mit der Villa bei Vittorio Veneto geschehen, die der Conte und die Contessa nicht mehr bewohnten und die auch Brunetti und seine Familie nur noch äußerst selten nutzten? Während sie schwankten und zauderten, war unter den Fenstern an der Nordseite Wasser ins Gemäuer eingedrungen, und nun verlangte der Verwalter auch noch eine erhebliche Lohnerhöhung. Als könne er Brunettis Gedanken lesen, bemerkte der Conte: »Es geht nicht um die Villa, auch wenn Gonzalo mich an sie erinnert.« Irritiert von dem Vergleich, meinte Brunetti trocken: »Ich wusste gar nicht, dass ihm Wasser in den Schädel läuft.« Der Conte ignorierte Brunettis etwas respektlose Bemerkung und erklärte: »Du hast beide, Gonzalo und die Villa, ungefähr zur selben Zeit kennengelernt, Guido; du hast dich in ihrer Gegenwart immer wohl gefühlt; doch jetzt nagt an beiden der Zahn der Zeit.« Gonzalo Rodríguez de Tejeda, der Freund seiner Schwiegereltern und Paolas Patenonkel, gehörte zur Familie Falier, seit Brunetti denken konnte. Zu Brunettis und Paolas zehntem Hochzeitstag war er eigens aus London angereist, um ihnen sein Geschenk zu überreichen, eine Tonschale aus dem zwölf ten Jahrhundert, wüstengelb und von der Größe einer Salatschüssel, an der Innenseite aber mit einer kufischen Inschrift verziert, bei der es sich vermut lich um einen Koranvers handelte. Gonzalo hatte für die Schale vorsorglich einen Plexiglaskasten anfertigen lassen, zum Schutz vor Attacken und Missgeschicken, wie sie in einem Haushalt mit kleinen Kindern vorkamen. Noch heute hing die Schale bei den Brunettis im Wohnzimmer an der Wand, zwischen den zwei Fenstern mit Blick auf den Glockenturm von San Marco. Wenn Brunetti und Gonzalo sich in den vergangenen Jahren auf der Straße, in einem Geschäft oder im Café begegnet waren, hatten sie jedes Mal zusammen eine ombra oder einen Kaffee getrunken und nett miteinander geplaudert. Erst vor wenigen Monaten war ihm Gonzalo in der Nähe des Campo Santi Apostoli über den Weg gelaufen. Als Brunetti den Älteren über den Campo auf sich zueilen und eine Hand zum Gruß heben sah, war ihm aufgefallen, dass Gonzalos Haar sich von Eisengrau zu Schneeweiß verfärbt hatte; doch noch immer hielt er sich kerzengerade wie ein alter Soldat, und seine stahlblauen Augen strahlten wie eh und je – vielleicht das Erbe der Invasoren aus dem Norden, die Spanien einst heimgesucht hatten. Sie hatten sich umarmt und einander beteuert, wie sehr sie sich über die Begegnung freuten, dann aber hatte Gonzalo in seinem vollkommen akzentfreien Italienisch erklärt, er müsse dringend zu einer Verabredung und habe leider keine Zeit für eine Unterhaltung, lasse jedoch Paola und den Kindern Grüße und Küsse überbringen. Wie so oft strich er als Zeichen der Zuneigung über Brunettis Wange, wiederholte, nun aber müsse er gehen, wandte sich ab und entschwand eilig in Richtung Fondamenta Nuove und des Palazzo, in dem er wohnte. Brunetti blieb stehen und sah ihm nach, wie immer glücklich, Gonzalo begegnet zu sein. Dann ging er weiter, drehte sich aber noch einmal um und versuchte, in der Menge den Rücken seines Freundes zu erspähen. Anfangs hielt er nach einem eilig ausschreitenden Mann Ausschau und fand ihn nicht, dann aber entdeckte er ihn, den großen Mann, der jetzt nur noch langsam ging, mit gesenktem Kopf, die Ellbogen abgewinkelt, eine Hand an der Hüfte, als habe er Schmerzen, die er sich vor anderen nicht anmerken lassen wollte. Brunetti hatte betroffen den Blick abgewandt. Aus seiner Erinnerung aufschreckend, bemerkte Brunetti, dass sein Gegenüber ihn aufmerksam beobachtete. »Wann hast du ihn zuletzt gesehen?«, fragte der Conte. »Vor zwei Monaten. Vielleicht etwas mehr«, antwortete Brunetti. »Auf dem Campo Santi Apostoli, aber wir konnten nur ein paar Worte wechseln.« »Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht?« »Wie immer, würde ich sagen«, versuchte Brunetti automatisch, einen Älteren vor der Erkenntnis zu bewahren, dass der Gleichaltrige jenen Mächten erlegen war, gegen die sie beide kämpften. Brunetti wich dem Blick des Conte aus und betrachtete das Porträt eines jungen Edelmanns an der Wand gegenüber, der wiederum ihn zu mustern schien. Jugendfrisch und voller Leben, mit Muskeln, die sich gegen die Fesseln der vom Maler verlangten Pose auf lehnten, stand er da, die Linke locker an der Hüfte, die Rechte am Knauf seines Degens: Zweifellos irgendein Vorfahr von Paola, ein Falier, der im Kampf, an einer Krankheit oder am Alkohol gestorben war, nachdem er sich durch dieses Bild in der Blüte seiner Jahre hatte verewigen lassen. Brunetti glaubte, Züge von Paolas Gesicht wiederzuerkennen, aber die Jahrhunderte hatten bei ihr doch manches geglättet, und nur wenn sie einmal in Zorn geriet, hatte sie jene Raubvogelaugen auf der Suche nach Beute. »Ihr habt euch nicht länger unterhalten?« Brunetti schüttelte den Kopf. Der Conte senkte den Blick, stemmte die Hände auf die Oberschenkel und starrte gedankenverloren darauf herunter. Was für ein stattlicher Mann er immer noch ist, dachte Brunetti. Er nutzte die Gelegenheit, den Conte genauer anzusehen, und stellte zu seiner Überraschung fest, dass sein Schwiegervater seit ihrer letzten Begegnung kleiner geworden war. Oder vielmehr, seit er das letzte Mal auf die äußere Erscheinung des Älteren geachtet hatte. Die Schultern waren schmaler, doch das Jackett umspielte diese schmaleren Schultern noch immer sanft. Vielleicht hat er es ändern lassen, dachte Brunetti, bemerkte dann aber die modischen Aufschläge dieser Saison – also war es neu. Der Conte betrachtete weiter seine Handrücken, als ließe sich dort eine Antwort finden; schließlich blickte er auf und sagte: »Du bist immer in einer heiklen Lage, nicht wahr, Guido?« War das eine Frage oder eine Meinungsäußerung?, überlegte Brunetti. Bezog es sich auf den Rangunterschied zwischen ihm – dem Sohn eines Mannes aus der Unterschicht, der sein Leben lang nur Niederlagen erlitten hatte – und Paola, der Tochter von Conte Falier und Erbin eines der größten Vermögen der Stadt? Oder womöglich auf seine beruf lichen Pflichten im Gegensatz zu den Ansprüchen, die Freundschaft und Liebe an ihn stellen mochten? Oder ging es um seine Lage als Commissario der Polizei, der in die Familie eines Mannes eingeheiratet hatte, mit dessen Geschäften man sich besser nicht genauer befasste? Brunetti scheute sich zu fragen, worauf der Conte hinauswollte, und improvisierte stattdessen: »Ich denke, viele von uns geraten gelegent lich in heikle Lagen. Das ist der Lauf der Welt.« Der Ältere nickte und legte die Hände auf den Sessellehnen ab. »Ich weiß noch, wie Paola, als sie in England studierte, uns einmal hier besuchen kam. Die meiste Zeit las sie ein Buch, über das sie eine Arbeit schreiben musste.« Seine Züge verklärten sich bei der Erinnerung an sein einziges Kind, das nach Hause gekommen war und den Kopf über seine Lektüre beugte. Brunetti, vertraut mit den Erzählgewohnheiten des Conte, wartete ruhig ab. »Erst am dritten Tag begann sie von dem Buch zu sprechen und von dem, was sie darüber schreiben wollte.« »Was hat sie gesagt?« Warum, fragte sich Brunetti, sind wir immer so interessiert an dem, was geliebte Menschen früher einmal erlebt haben? »Dass ich es auch lesen sollte«, antwortete der Conte. »Ich habe es versucht, nachdem sie wieder nach England zurückgefahren war.« Er schüttelte den Kopf wie jemand, der ein Geständnis macht. »Ich kann mit so etwas nichts anfangen – es ging um Religion, ich konnte es nicht lesen.« »Welches Buch war das?«, fragte Brunetti, neugierig.
Donna Leon
Ein Sohn ist uns gegeben
Commissario Brunettis achtundzwanzigster Fall
Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz
Diogenes, 2019
320 S., CHF 27. € 20.99.
978-3-257-60951-6
Auch erhältlich als eBook

