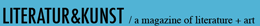Ein Gespräch in der Mühle Tiefenbrunnen in Zürich über "Formeln oder Freiheit"

Priska Seiler Graf (*1968), Nationalrätin (SP), Sicherheitspolitikerin, ehemalige Lehrerin und Ballettpädagogin.

Stefan Legge (*1984), Ökonom am Institut für Volkswirtschaft der Universität St. Gallen (HSG)

Peter Preissle (*1956), einst Veranstalter der Zürcher Punkbewegung, heute Kunstsammler Fotos: © Julieta Schildknecht
«Schweizer Demokratie und Neutralität im Zeitalter von KI, Zollkriegen und Cancel Culture»
Von Julieta Schildknecht
Der Sitzungsraum in der Mühle Tiefenbrunnen liegt im sanften Schatten der grossen Fenster, durch die das Licht des Spätsommers fällt. Draussen brütet die Augusthitze, drinnen sitzen drei Persönlichkeiten mit gänzlich unterschiedlichen Biografien – vereint in der Bereitschaft, die grossen Fragen unserer Zeit ohne Rücksicht auf bequeme Antworten zu diskutieren.
Die Moderatorin legt Karten mit Leitfragen aus – kleine, beschriebene Inseln inmitten der noch offenen See des Gesprächs. Sie wirken wie Einladung und Herausforderung zugleich: Orientierung geben, ohne den Kurs festzuschreiben:
Wie steht es um die demokratische Mitgestaltung in der Schweiz? Was bedeutet Neutralität im Zeitalter künstlicher Intelligenz, internationaler Zollkriege und Cancel Culture? Und wie wichtig sind öffentliche Infrastrukturen als Orte der Teilhabe und des Austauschs?
Am Tisch der Gesprächsrunde:
- Priska Seiler Graf (*1968), Nationalrätin (SP), Sicherheitspolitikerin, ehemalige Lehrerin und Ballettpädagogin; Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats über Nachrichtendienstreformen, Terrorismusbekämpfung und die Rolle der Schweiz in der europäischen Sicherheitszusammenarbeit.
-
- Dr. Stefan Legge (*1984), Schweizer und deutscher Wirtschaftswissenschaftler an der Universität St. Gallen (HSG), lehrt Volkswirtschaftslehre, u.a. Fellow des Weltwirtschaftsforums.
-
- Peter Preissle (*1956), einst Veranstalter der Zürcher Punkbewegung; heute Kunstsammler und eine engagierte Stimme in Debatten über Stadtkultur und die gesellschaftliche Rolle der Kunst. Stets an seiner Seite: Maximilian, sein Hund, der während des Gesprächs aufmerksam unter dem Tisch liegt, als würde er jede Pointe verstehen.
Neutralität – Prinzip, Mythos, Zukunft
„Neutralität war lange akzeptiert, ein Vorteil für uns“, beginnt Priska Seiler Graf. „Aber immer öfter wird die Schweiz als Rosinenpickerin gesehen. Die Neutralitätsinitiative der SVP ist in Wahrheit eine Anti-Sanktions-Initiative. Wir müssen uns fragen: zu wem gehören wir – und wie stehen wir solidarisch ein?“
Sie erinnert daran, dass die Schweizer Neutralität historisch militärisch gemeint war, heute aber vor allem wirtschaftlich und politisch bewertet wird: „Wer im Parlament erlebt, wie Sanktionen diskutiert werden, weiss, dass es nicht um Schwarz oder Weiss geht, sondern um komplexe Abwägungen – und die sind oft unbequem.“
Stefan Legge verankert das im geopolitischen Wandel: „Wir gehen von einer regel- zu einer machtbasierten Weltordnung. Die USA setzen offen auf protektionistische Politik – Buy America, hohe Zölle auf Stahl, Autos und Agrarprodukte. Früher hat man solche Massnahmen als technische Standards verpackt, heute ist es unverblümt. Das berühmte Motto ‚small yard with a high fence‘ steht für den Versuch, den Hightech-Bereich vor China abzuschotten. China wiederum ist seit den Olympischen Spielen 2008 selbstbewusst und strategisch – historisch war es immer ein Machtzentrum. Für die Schweiz bedeutet das: Wir sind klein, wir leben vom Export – ob in der Pharma, im Maschinenbau, in der Finanzindustrie oder bei Konzernen wie Nestlé. Unser Wohlstand steht und fällt mit offenen Märkten und klaren Regeln. Ohne regelbasierte Ordnung wären wir im Recht des Stärkeren chancenlos.“
Peter Preissle bringt seine Lebenserfahrung ein: „Früher haben wir uns rausgehalten und mit jedem Geschäfte gemacht. Heute? Das wird nicht mehr gehen. Neutralität wirkt wie ein Auslaufmodell. Und wenn man sich nicht entscheidet, entscheidet irgendwann jemand für einen.“
Von Punk zu Politik – persönliche Führungswege
Preissle erinnert an seine Lehrjahre in der Zürcher Punkbewegung: „1977 holten wir die Ramones und The Clash nach Zürich, damals im Umfeld der ersten Jugendunruhen. Die Energie war enorm – keine Genehmigungen, keine Sponsoren, nur Netzwerke. Ich habe in dieser Zeit gelernt: Führe, ohne alles unter Kontrolle zu haben. Wenn du warten musst, bis alle überzeugt sind, passiert gar nichts.“
Seiler Graf spricht von der „Ochsentour“ der Kommunalpolitik: „In Kloten habe ich gelernt, dass politische Führung nicht nur bedeutet, Mehrheiten zu suchen, sondern Vertrauen aufzubauen – auch bei denen, die nicht meiner Partei angehören.“
Sie ergänzt: „Das Schweizer Parlament ist eine Konsensmaschine. Wir haben keine Regierung und Opposition im klassischen Sinn, sondern müssen Mehrheiten über Fraktionsgrenzen hinweg suchen. Das dauert, aber es macht Entscheidungen tragfähiger. Gerade in der Sicherheitspolitik habe ich erlebt, dass manchmal Eile geboten ist – nach den Anschlägen in Paris oder Brüssel mussten Gesetze in Rekordzeit verabschiedet werden. Diese Balance zwischen Tempo und Sorgfalt ist echte Führungsarbeit.“
Legge, zwischen akademischer Forschung und politischer Beratung, betont die Führungsqualität, Trade-offs klar zu kommunizieren: „In der Ökonomie ist jede Entscheidung ein Abwägen. Politisch aber wollen viele alles gleichzeitig – das führt zu Enttäuschungen. Leadership heisst, auch das Unpopuläre ehrlich zu benennen.“
Wachstum, Degrowth – und der Mut zum Weniger
Das Gespräch springt von globalen Handelsbeziehungen zur Landwirtschaft.
Preissle: „Die Milchabgabestelle im Dorf ist heute ein Museum. Wir haben Jaks, schottische Hochlandrinder, Freilaufställe – alles industriell. Die heile Welt ist vorbei.“
Seiler Graf knüpft an: „Wir haben uns seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr einschränken müssen. Das Maß ist verloren gegangen. Weniger muss nicht Verlust bedeuten. Verzicht muss sexy werden.“
Legge bleibt Realist: „Die meisten wollen nicht weniger haben, sondern mehr. Politisch ist es schwer, ‚Degrowth‘ zu verkaufen. Aber ohne Reduktion bei Ressourcenverbrauch und Emissionen wird es nicht gehen. Und das gilt nicht nur ökologisch – auch ökonomisch stossen wir an Grenzen: Arbeitskräfte, Rohstoffe, CO₂-Budgets sind knapp. Wer das ignoriert, verkauft Illusionen.“
Migration – Realität gestalten
„Migration passiert – ob wir wollen oder nicht,“ sagt Legge. „Die Wirtschaft holt Talente aus aller Welt, ohne sie gäbe es viele unserer Konzerne nicht. Aber Asyl und Wirtschaftsmigration werden oft vermischt – das verzerrt die Debatte. Erfolgreiche Integration ist wie ein frisch gebackener Zopf: Einmal gelingt er grossartig, aber hunderttausendfach in gleichbleibender Qualität ist es schwieriger. Dafür braucht es mehr Ressourcen: Sprachkurse, Wohnraum, Integrationsangebote. Und diese müssen skalierbar sein – sonst bricht das System an den Rändern.“
Seiler Graf bringt die sicherheitspolitische Perspektive ein: „Wir brauchen Regeln, und wir brauchen Integration. Beides gelingt am besten gemeinsam mit der EU. Grenzschliessungen funktionieren nicht – und sie würden uns in anderen Bereichen, etwa bei Sicherheitsabkommen oder Schengen, schaden.“
Dann wird sie konkret: „In Kloten haben wir erlebt, dass Vereine und Schulen entscheidend sind, um Kinder und Familien einzubinden. Integration ist keine Einbahnstrasse – es ist auch unsere Aufgabe, Räume zu schaffen, in denen Begegnung möglich wird.“
Preissle erinnert an seine kommunalpolitische Zeit: „In Kloten hat sich die Bevölkerung in fünf Jahren halb ausgetauscht. Wer weiss, dass er bald wieder weg ist, engagiert sich selten vor Ort. Das macht lokale Demokratie verletzlich.“
Medienkompetenz – Bollwerk der Demokratie
Seiler Graf spricht über Fake News und gezielte Desinformation: „Russische Propaganda ist ein Teil moderner Kriegsführung. Ich habe erlebt, wie Lügen über mich verbreitet wurden – und wie viele sie geglaubt haben. Politische Bildung muss deshalb schon in der Schule beginnen. Junge Menschen sollten nicht nur lernen, wie unser System funktioniert, sondern auch, wie man Quellen prüft und mit Enttäuschung umgeht, wenn das eigene Anliegen an der Urne scheitert.“
Legge empfiehlt eine Übung, die er Studierenden mitgibt: „Lest jeden Tag eine Zeitung – und wechselt regelmässig das Abo. Zwei Monate NZZ, dann Tages-Anzeiger, dann Süddeutsche. So vermeidet ihr geistige Einbahnstrassen und seht, wie unterschiedlich die gleichen Fakten interpretiert werden.“
Das Schweizer System – Kraft und Gefahr der Institutionen
Seiler Graf fasst es zusammen: „Unsere Demokratie ist robust, aber nicht unverwundbar. Institutionen leben nur, wenn wir sie pflegen – und das heisst auch, dass wir bereit sind, unbequeme Entscheidungen zu treffen.“
Legge warnt: „Institutionen sind keine Selbstläufer. Man muss sie an neue Realitäten anpassen – sonst verlieren sie ihre Wirkung. Das gilt auch für unsere internationale Position: Wer glaubt, sich dauerhaft aus allen Regeln heraushalten zu können, wird irgendwann vom Spielfeld gedrängt.“
Zürich, KI und Sicherheitsgefühl
Preissle wird persönlicher: „Ich bin seit Jahrzehnten in Zürich – und die Stadt hat sich komplett verändert. Früher war die Altstadt voller kleiner Lokale, verraucht, laut, voller spontaner Begegnungen. Heute sind viele verschwunden, abends wirkt es oft leer. Und künstliche Intelligenz? Für mich ist das künstlich im wörtlichen Sinn – sie hat nichts mit Kunst zu tun. Aber sie verändert, wie wir Informationen konsumieren und wie Sicherheit empfunden wird. Früher war Sicherheit ein Gefühl, heute ist sie eine Frage von Daten.“
Schlussakkord: James Baldwin
Wie James Baldwin 1955 in Notes of a Native Son schrieb, ist „Wahrheit“ keine Parole im Dienst einer Sache, sondern eine kompromisslose Hingabe an das unberechenbare, widersprüchliche Wesen des Einzelnen. In einer Zivilisation, die Menschen zu kalkulierbaren Einheiten mechanisiert, liegt die Aufgabe der Kunst – und ebenso des Journalismus – darin, diese Ambivalenz sichtbar zu machen und der Versuchung zu widerstehen, moralisch abgesicherte, gesellschaftlich genehmigte Lügen zu wiederholen. Denn nur in der Zumutung der ganzen unbekürzten Wahrheit liegt die Chance auf Freiheit und Selbsterkenntnis.
Baldwins Gedanken fallen wie ein leiser Gong am Ende. – Das Gespräch löst sich auf, doch seine Botschaft bleibt: Demokratie ist kein Zustand, sondern eine Praxis – sie lebt vom Mut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und Komplexität auszuhalten.